 Carl
Offterdinger 1888
Carl
Offterdinger 1888E. T. A. Hoffmann: Nußknacker und Mausekönig
 Carl
Offterdinger 1888
Carl
Offterdinger 1888
|
|
Hoffmanns Märchen Nußknacker und Mausekönig entstand im November 1816 und wurde in dem Band Kinder-Mährchen (Von E. W. Contessa, Friedrich Baron de la Motte Fouque, und E. T. A. Hoffmann. Berlin, 1816. In der Realschulbuchhandlung) erstmals veröffentlicht. Der Text erschien im Jahre 1819 erneut mit nur wenigen redaktionellen Veränderungen im 2. Abschnitt des ersten Band der Serapionsbrüder. |
Die Serapionsbrüder ist eine 1819 bis 1821
veröffentlichte Sammlung von Erzählungen und Aufsätzen von E. T. A. Hoffmann.
Hoffmann stellte die vier Bände zu großen Teilen aus bereits vorher
veröffentlichtem Material zusammen, fügte aber einige neue Erzählungen sowie
eine Rahmenhandlung hinzu, in der einige literarisch gebildete Freunde über
Probleme der Kunst diskutieren und als fiktive Autoren der Erzählungen
auftreten. Vorbild für diesen Freundeskreis waren die Treffen der Serapionsbrüder, eines Kreises um Hoffmann, dem neben weiteren
Schriftstellern auch Adelbert von Chamisso und Friedrich de la Motte Fouqué
angehörten. Der Name leitete sich ursprünglich vom Heiligen Serapion her, an
dessen Gedenktag – dem 14. November – der Freundeskreis sich zum ersten Mal nach
längerer Trennung im Jahr 1818 wieder zusammenfand. Wichtiger als dieser äußere
Anlass wird aber das so genannte serapiontische Prinzip, dem sich die Mitglieder
des Kreises verpflichtet fühlen.
Über die tatsächlichen Vorbilder für den
Freundeskreis, der die Rahmengespräche der „Serapionsbrüder“ bestreitet, schreibt
der Schriftsteller und Verleger Julius Eduard
Hitzig (1780–1849): „Die
Grundpfeiler dieses Vereins bildeten nächst Hoffmann, Contessa, Koreff, ein
ausgezeichneter Arzt*) und Hitzig. Ein vortrefflicher ineinandergreifendes
Quatuor mochte nicht leicht zu finden sein. Koreff war der einzige Mensch, dem
Hoffmann geduldig zuhörte, weil er ihn in der Unterhaltung an sprudelndem
lebendigem Witze oft und an Kenntnissen immer überbot, auch dabei gutmütig genug
war, ihn reden zu lassen, so oft er wollte; Contessa, selbst wenig redend,
horchte auf alles, was die Freunde an Witz ausgehen ließen, mit dem beredtesten
Beifallslächeln, das ihm unaufhörlich um die Mundwinkel spielte, von Zeit zu
Zeit ein kleines, aber entscheidendes Wörtchen zugebend, und Hitzig, der mit
Contessa das Publikum bildete und alle drei übrigen länger und besser als sie
sich untereinander kannte, verstand darum die Kunst, Lücken im Gespräch
auszufüllen, und wo es matt wurde, es wieder anzuregen, sich willig jedes
Anspruchs auf Solopartien begebend.“
An der mit *) bezeichneten Stelle fügt Hitzig die Fußnote ein: „Sprechend sind
beide gezeichnet, Serapions-Brüder Band 2. Contessa, als Sylvester S 4., und
Koreff, als Vinzenz, S. 6.“
Außer den vier Teilnehmern Hoffmann, Hitzig, Contessa und Koreff werden noch Theodor Gottlieb von Hippel, Friedrich de la Motte Fouqué, Ludwig Robert, Adelbert von Chamisso sowie einige nur sporadische Gäste genannt. In den Rahmengesprächen der „Serapionsbrüder“ treten insgesamt sechs Figuren auf. Ihre Identifikation mit den historischen Teilnehmern des Serapions-Kreises ist zum einen Teil spekulativ, zum anderen Teil hat Hoffmann die realen Figuren nur als Anregung für die literarische Charakterisierung genommen.
Glaubhaft, aber nicht als realitätsnahe Personenzeichnung zu werten sind die Zuschreibungen:
Theodor: E.T.A. Hoffmann;
Ottmar: Julius Eduard Hitzig;
Sylvester: Karl Wilhelm Salice-Contessa;
Vinzenz: David Ferdinand Koreff.
Spekulativ dagegen sind die Zuschreibungen:
Lothar: Friedrich de la Motte Fouqué;
Cyprian: Adelbert von Chamisso.
Das serapiontische Prinzip
Programmatisch für das serapiontische Prinzip, das
„wie Theodor sehr richtig bemerkte, eben nichts weiter heißen wollte, als daß
[die Serapionsbrüder] übereingekommen, sich durchaus niemals mit schlechtem
Machwerk zu quälen“, ist die Absage an jede Art von Nachahmungspoetik und jeden
sogenannten Realismus. Nicht die Außenwelt soll durch die Dichtung abgebildet
werden, sondern es gilt, „das Bild, das [dem wahren Künstler] im Innern
aufgegangen“, durch „poetische Darstellung ins äußere Leben zu tragen“. Wie
Serapion, der als weltfremder Eremit nur seinen Visionen folgte, soll auch der
Dichter sich von der Einsamkeit als idealer Sphäre seines schöpferischen Geistes
inspirieren lassen. Je mehr ihm die Welt zum bloßen Störfaktor wird, desto
autonomer, genialer und serapiontischer sein Werk. Indem die fiktiven Erzähler
der Novellensammlung über die serapiontische Qualität ihrer Texte diskutieren,
wird die ästhetische Reflexion – ganz im Sinne romantischer Poetologie – selbst
zum Bestandteil der Poesie. Verwirrend für die Interpreten E.T.A. Hoffmanns sind
dabei die für ihn so charakteristischen visionär-phantastischen Projektionen,
mit denen er die künstlerische Innenschau mit der alltäglichen Wirklichkeit
verbindet und dabei eine typisch serapiontische Mischung aus Phantasie und
Realität schafft, die für den Leser nur noch schwer zu entwirren ist.
Wikipedia
|
Der Text folgt der Ausgabe: Die Serapions-Brüder. Gesammelte Erzählungen und Märchen. Herausgegeben von E. T. A. Hoffmann. Erster Band. Berlin 1819. Nußknacker und Mausekönig, S. 466-604. |
|
Die Abbildungen im Text stammen aus: Nußknacker und Mäusekönig. Ein allerliebstes Kindermährchen nach E. T. A. Hoffmann. Oder Neueste Bilderlust in X feinen illuminirten Kupfertafeln nach Original-Zeichnungen von P. C. Geißler. Nürnberg: Verlag der C. H. Zeh’schen Buchhandlung. O. J. (1840)

Das Märchen ist in folgenden Erzähl-Rahmen eingebettet:
|
„Ich merke“, sprach Theodor, als er geendet und die Freunde schweigend vor sich hinblickten, „ich merke es wohl, daß euch meine Erzählung nicht ganz recht ist, oder behagte euch nur in diesem Augenblick vielleicht nicht der düstre wehmütige Stoff?“ „Es ist nicht anders“, erwiderte Ottmar, „deine Erzählung läßt einen sehr wehmütigen Eindruck zurück, aber, aufrichtig gestanden, will mir all der Aufwand von schwedischen Bergfrälsebesitzern, Volksfesten, gespenstischen Bergmännern und Visionen gar nicht recht gefallen. Die einfache Beschreibung in Schuberts Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft, wie der Jüngling in der Erzgrube zu Falun gefunden wurde, in dem ein altes Mütterchen ihren vor funfzig Jahren verschütteten Bräutigam wieder erkannte, hat viel tiefer auf mich gewirkt.“ „Ich flehe“, rief Theodor lächelnd, „unsern Patron den Einsiedler Serapion an, daß er mich in Schutz nehme, denn wahrlich, mir ging nun einmal die Geschichte von dem Bergmann mit den lebendigsten Farben gerade so auf wie ich sie erzählt habe.“ „Laßt“, sprach Lothar, „jedem seine Weise. Aber gut ist es, lieber Theodor, daß du uns die Geschichte vorlasest, die wir alle, mein ich, etwas von der Bergmannswissenschaft, so wie von den Bergwerken zu Falun und den schwedischen Sitten und Gebräuchen gehört haben. Andere würden dir mit Recht vorwerfen, daß du durch zu viele bergmännische Ausdrücke oft unverständlich wurdest, und manche würden sogar, da du so oft von dem schönen Öl sprichst womit sich die Leute traktieren, auf den Gedanken geraten, daß die guten Faluner und Götaborger schnödes Baumöl saufen, da jenes Öl doch nichts anders ist als ein schönes, starkes Bier.“ „Mir hat“, nahm Cyprian das Wort, „Theodors Erzählung doch im ganzen nicht so sehr mißfallen als dir Ottmar. Wie oft stellten Dichter Menschen, welche auf irgendeine entsetzliche Weise untergehen, als im ganzen Leben mit sich entzweit, als von unbekannten finstren Mächten befangen dar. Dies hat Theodor auch getan, und mich wenigstens spricht dies immer deshalb an, weil ich meine, daß es tief in der Natur begründet ist. Ich habe Menschen gekannt, die sich plötzlich im ganzen Wesen veränderten, die entweder in sich hinein erstarrten oder wie von bösen Mächten rastlos verfolgt, in steter Unruhe umhergetrieben wurden und die bald dieses, bald jenes entsetzliche Ereignis aus dem Leben fortriß.“ „Halt“, rief Lothar – „halt! – lassen wir dem geisterseherischen Cyprian nur was weniges Raum, so geraten wir gleich in ein Labyrinth von Ahnungen und Träumen! – Erlaubt, daß ich unsere trübe Stimmung mit einemmal vernichte, indem ich euch zum Schluß unseres heutigen Klubs ein Kindermärchen mitteile, das ich vor einiger Zeit aufschrieb, und das mir, so glaub ich, der tolle Spukgeist Droll selbst eingegeben hat.“ „Ein Kindermärchen – du Lothar ein Kindermärchen!“ – So riefen alle. „Ja“, sprach Lothar, „wahnwitzig mag es euch bedünken, daß ich es unternahm, ein Kindermärchen zu schreiben, aber hört mich erst und dann urteilt.“ Lothar zog ein sauber geschriebenes Heft hervor und las: |
meine Erzählung: Die Bergwerke zu Falun, eine Erzählung von E. T. A. Hoffmann aus dem Zyklus Die Serapionsbrüder von 1819, behandelt das Leben des jungen Elis Fröbom, der seinen Beruf als Seefahrer aufgibt, um Bergarbeiter zu werden. Die Erzählung ist Teil einer umfangreichen literarischen Tradition zum Bergwerk von Falun und den mit diesem Bergwerk in der damaligen Zeit verbundenen Tragödien. Bergfrälsebesitzern: Bergfrälse wird in Schweden ein Stück Land genannt, das jemand an eine Bergbaugesellschaft verpachtet und für das er Anteile am Bergwerk erhält. Schuberts Ansichten: Gotthilf Heinrich Schubert: Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft. Dresden 1808. Enthält die Geschichte eines Leichenfundes in einem zugeschütteten Bergwerksschacht nahe der schwedischen Stadt Falun, die Hoffmann als Anregung für seine Erzählung diente. Patron: Patron (von lateinisch patronus ‚Schutzherr') bzw. Patronat steht für: Schirmherr. Der Einsiedler Serapion ist die erste Geschichte der Erzählungssammlung „Die Serapionsbrüder“ von E.T.A. Hoffmann. Götaburger: Einwohner von Göteburg, der zweitgrößten Stadt Schwedens Baumöl: Olivenöl, auch Baumöl genannt, ist ein Pflanzenöl aus dem Fruchtfleisch und aus dem Kern von Oliven, den Früchten des Ölbaums. der tolle Spukgeist Droll: Elfe, Kobold und Poltergeist in Shakespeares „Ein Sommmernachtstraum“.
Entstehung und Textüberlieferung Die Ausgabe
der Kinder-Märchen, die im folgenden Jahr um ein »Zweites Bändchen« vermehrt
wurde, geht, ähnlich wie der geplante Roman des Freiherrn von Vieren, auf eine Verabredung zurück, die Contessa, Fouque und E.
T. A. Hoffmann wohl schon 1815 getroffen hatten. Ein Brief von Hoffmann an
Fouque, in dem er am 8. Mai 1815 darüber klagt, daß er nicht zum »Märchen
machen« komme, scheint darauf hinzudeuten. Näheres über die Entstehung läßt
jedoch erst Hoffmanns Brief an Fouque vom 29. Oktober 1816 erkennen. Danach war
zu diesem Zeitpunkt noch Duncker und Humblot als Verleger des Märchenbuches
vorgesehen gewesen, der jedoch »das Werkchen erst zu Ostern erscheinen lassen«
wollte und offensichtlich auch an ein umfangreicheres Buch dachte. So wechselte
man innerhalb von 14 Tagen vom Verleger der Elixiere des Teufels zum Verleger
der Nachtstücke, Georg Reimer, der die Realschulbuchhandlung betrieb. Dieser
brachte denn auch das Buch in der Tat noch vor Weihnachten auf den Markt, obwohl
er die Zeichnungen zu den Vignetten und die Manuskripte von Fouques Die kleinen
Leute und von Hoffmanns Märchen erst am 16. November 1816 erhielt
(vgl. Hoffmanns Brief von diesem Tag). Hoffmann hat sein Kindermärchen im
Wesentlichen zwischen dem 29. Oktober und dem 16. November 1816
niedergeschrieben und die Vignetten unmittelbar vor der Absendung des Märchens
fertiggestellt: »Ich glaube daß die leichte Aquatinta-Manier die beste zu jenen
kleinen Bilderchen seyn wird. So viel möglich, habe ich immer den Titel genau in
der Vignette, sowie das Resultat in der Schluß-Arabeske bezeichnen wollen!« (an
Georg Reimer, 16. 11. 1816). |
|
Der Weihnachtsabend Am vierundzwanzigsten Dezember durften die Kinder des Medizinalrats Stahlbaum den ganzen Tag über durchaus nicht in die Mittelstube hinein, viel weniger in das daranstoßende Prunkzimmer. In einem Winkel des Hinterstübchens zusammengekauert, saßen Fritz und Marie, die tiefe Abenddämmerung war eingebrochen und es wurde ihnen recht schaurig zumute, als man, wie es gewöhnlich an dem Tage geschah, kein Licht hereinbrachte. Fritz entdeckte ganz insgeheim wispernd der jüngern Schwester (sie war eben erst sieben Jahr alt worden) wie er schon seit frühmorgens es habe in den verschlossenen Stuben rauschen und rasseln, und leise pochen hören. Auch sei nicht längst ein kleiner dunkler Mann mit einem großen Kasten unter dem Arm über den Flur geschlichen, er wisse aber wohl, daß es niemand anders gewesen als Pate Droßelmeier. Da schlug Marie die kleinen Händchen vor Freude zusammen und rief: „Ach was wird nur Pate Droßelmeier für uns Schönes gemacht haben.“ Der Obergerichtsrat Droßelmeier war gar kein hübscher Mann, nur klein und mager, hatte viele Runzeln im Gesicht, statt des rechten Auges ein großes schwarzes Pflaster und auch gar keine Haare, weshalb er eine sehr schöne weiße Perücke trug, die war aber von Glas und ein künstliches Stück Arbeit. Überhaupt war der Pate selbst auch ein sehr künstlicher Mann, der sich sogar auf Uhren verstand und selbst welche machen konnte. Wenn daher eine von den schönen Uhren in Stahlbaums Hause krank war und nicht singen konnte, dann kam Pate Droßelmeier, nahm die Glasperücke ab, zog sein gelbes Röckchen aus, band eine blaue Schürze um und stach mit spitzigen Instrumenten in die Uhr hinein, so daß es der kleinen Marie ordentlich wehe tat, aber es verursachte der Uhr gar keinen Schaden, sondern sie wurde vielmehr wieder lebendig und fing gleich an recht lustig zu schnurren, zu schlagen und zu singen, worüber denn alles große Freude hatte. Immer trug er, wenn er kam, was Hübsches für die Kinder in der Tasche, bald ein Männlein, das die Augen verdrehte und Komplimente machte, welches komisch anzusehen war, bald eine Dose, aus der ein Vögelchen heraushüpfte, bald was anderes. Aber zu Weihnachten, da hatte er immer ein schönes künstliches Werk verfertigt, das ihm viel Mühe gekostet, weshalb es auch, nachdem es einbeschert worden, sehr sorglich von den Eltern aufbewahrt wurde. – „Ach, was wird nur Pate Droßelmeier für uns Schönes gemacht haben“, rief nun Marie; Fritz meinte aber, es könne wohl diesmal nichts anders sein, als eine Festung, in der allerlei sehr hübsche Soldaten auf und ab marschierten und exerzierten und dann müßten andere Soldaten kommen, die in die Festung hineinwollten, aber nun schössen die Soldaten von innen tapfer heraus mit Kanonen, daß es tüchtig brauste und knallte. „Nein, nein“, unterbrach Marie den Fritz: „Pate Droßelmeier hat mir von einem schönen Garten erzählt, darin ist ein großer See, auf dem schwimmen sehr herrliche Schwäne mit goldnen Halsbändern herum und singen die hübschesten Lieder. Dann kommt ein kleines Mädchen aus dem Garten an den See und lockt die Schwäne heran, und füttert sie mit süßem Marzipan.“ „Schwäne fressen keinen Marzipan“, fiel Fritz etwas rauh ein, „und einen ganzen Garten kann Pate Droßelmeier auch nicht machen. Eigentlich haben wir wenig von seinen Spielsachen; es wird uns ja alles gleich wieder weggenommen, da ist mir denn doch das viel lieber, was uns Papa und Mama einbescheren, wir behalten es fein und können damit machen, was wir wollen.“ Nun rieten die Kinder hin und her, was es wohl diesmal wieder geben könne. Marie meinte, daß Mamsell Trutchen (ihre große Puppe) sich sehr verändere, denn ungeschickter als jemals fiele sie jeden Augenblick auf den Fußboden, welches ohne garstige Zeichen im Gesicht nicht abginge, und dann sei an Reinlichkeit in der Kleidung gar nicht mehr zu denken. Alles tüchtige Ausschelten helfe nichts. Auch habe Mama gelächelt, als sie sich über Gretchens kleinen Sonnenschirm so gefreut. Fritz versicherte dagegen, ein tüchtiger Fuchs fehle seinem Marstall durchaus so wie seinen Truppen gänzlich an Kavallerie, das sei dem Papa recht gut bekannt. – So wußten die Kinder wohl, daß die Eltern ihnen allerlei schöne Gaben eingekauft hatten, die sie nun aufstellten, es war ihnen aber auch gewiß, daß dabei der liebe Heilige Christ mit gar freundlichen frommen Kindesaugen hineinleuchte und daß wie von segensreicher Hand berührt, jede Weihnachtsgabe herrliche Lust bereite wie keine andere. Daran erinnerte die Kinder, die immerfort von den zu erwartenden Geschenken wisperten, ihre ältere Schwester Luise, hinzufügend, daß es nun aber auch der Heilige Christ sei, der durch die Hand der lieben Eltern den Kindern immer das beschere, was ihnen wahre Freude und Lust bereiten könne, das wisse er viel besser als die Kinder selbst, die müßten daher nicht allerlei wünschen und hoffen, sondern still und fromm erwarten, was ihnen beschert worden. Die kleine Marie wurde ganz nachdenklich, aber Fritz murmelte vor sich hin: „Einen Fuchs und Husaren hätt ich nun einmal gern.“ Es war ganz finster geworden. Fritz und Marie fest aneinandergerückt, wagten kein Wort mehr zu reden, es war ihnen als rausche es mit linden Flügeln um sie her und als ließe sich eine ganz ferne, aber sehr herrliche Musik vernehmen. Ein heller Schein streifte an der Wand hin, da wußten die Kinder, daß nun das Christkind auf glänzenden Wolken fortgeflogen zu andern glücklichen Kindern. In dem Augenblick ging es mit silberhellem Ton: Klingling, klingling, die Türen sprangen auf, und solch ein Glanz strahlte aus dem großen Zimmer hinein, daß die Kinder mit lautem Ausruf: „Ach! – Ach!“ wie erstarrt auf der Schwelle stehenblieben. Aber Papa und Mama traten in die Türe, faßten die Kinder bei der Hand und sprachen: „Kommt doch nur, kommt doch nur, ihr lieben Kinder und seht, was euch der Heilige Christ beschert hat.“
|
Schon zum Einstieg wählt
Hoffmann ein romantisches Motiv: Das Märchen beginnt am Weihnachtsabend. Im
Zuge der Idealisierung von Kindheit wird das Weihnachtsfest als Fest für
Kinder zu einer Möglichkeit des nostalgischen Rückbezugs in die eigene
Kindheit. Weitere Aspekte des romantischen Kindheitsbildes manifestieren
sich in der Hauptfigur Marie: sie hat eine verklärte Sicht auf
Alltagsgegenstände, besitzt die Fähigkeit zur Einbindung der Gegenstände in
die Phantasiewelt und zu einem unbefangenen Umgang mit dem Wunderbaren.
Dennoch ist Marie kein naives Kind, sie kann ebenso wie ihr Bruder Fritz als
„aufgeklärtes“ Kind betrachtet werden, denn beide sind sich bewusst, dass
ihnen nicht der „liebe Heilige Christ“, sondern ihre Eltern und der Pate die
Weihnachtsgeschenke bescheren. Ebenso wird betont, dass Marie sich nicht
gleich den phantastischen Ereignissen hingibt, sondern die Diskrepanz
zwischen realer und phantastischer Welt durchaus bemerkt: „Bin ich nicht ein
töricht Mädchen, daß ich so leicht erschrecke, so daß ich sogar glaube, das
Holzpüppchen da könne mir Gesichter schneiden!“ (S. 33). Doch ihre Phantasie
scheint sich nicht zähmen zu lassen, so dass sie von den außerordentlichen
Ereignissen vollkommen eingenommen wird. die Kinder: Julius Eduard Hitzig, Hoffmanns Serapionsbruder, Kollege und Biograph, berichtet in seiner Lebensgeschichte Hoffmanns, der Dichter habe das Märchen Nußknacker und Mausekönig für seine, Hitzigs, Kinder geschrieben, die darin sogar, »zu ihrer höchsten Freude, unter ihren Namen erschienen«. Tatsächlich tragen die beiden Kinder des Märchens, Marie und Fritz, die Namen der beiden jüngeren Kinder Hitzigs, und die älteste Tochter Eugenie begegnet, gleichsam zur Entschädigung dafür, daß sie im Märchen nicht vorkommt, als »liebe Eugenie« mit »ihrem zarten Gemüt« wenigstens im Rahmengespräch. Hoffmann selbst hat diesen biographischen Zusammenhang, den er im Rahmengespräch noch etwas mystifizierte (»Ich las mein Märchen schon Leuten vor«, sagt der Erzähler Lothar, »die ich allein für meine kompetenten Kunstrichter anerkennen kann, nemlich den Kindern meiner Schwester«, indirekt in einem Brief bestätigt, den er Hitzig am 18.1. 1822 zum frühen Tode von dessen Tochter Marie schrieb: »Seltsam – jezt kann ich es wohl sagen – seltsam ist es wohl, daß es mir mit dem Kinde immer etwas eignes schien, und daß ich in manchem Augenblick, wenn sie in ernstes Sinnen versunken schien, in ihrem Antlitz (vorzüglich in den, dann starr werdenden Pupillen) – den frühen Tod deutlich las. […] Sie war für ein höheres Leben bestirnt und dem ist sie zugeeilt!« Mit dem starren Blick erscheint Marie tatsächlich mehrfach im Märchen.
Friedrich Hitzig, Aquarell von ETA Hoffmann
Fast
alles spricht dafür, daß Hoffmann ihren Bruder Friedrich Hitzig, der im
Märchen andauernd mit seinen Soldaten beschäftigt ist, auf jenem Aquarell
aus dem Jahre 1814/15 dargestellt hat, das Klaus Günzel so beschreibt:
»stämmig, selbstbewußt und offenbar schon des krähenden Kommandotons
mächtig, sitzt dieser preußische Dreikäsehoch auf seinem Stühlchen, in der
linken Hand den Holzsäbel, in der rechten einen Bleisoldaten, im Hintergrund
die Trommel«. Jedenfalls hatte Hoffmann zu den Kindern Hitzigs eine enge
Beziehung entwickelt; er war ihnen gegenüber, so schreibt Hitzig, »mittheilend,
und von einer Gemüthlichkeit, daß die Kinder Hitzig's sich des neu
angekommenen Freundes ihres Vaters nicht genug erfreuen konnten. So lebten
sie z. B., damals grade in der Hoffnung, ihren Liebling, Undine, mit
leiblichen Augen, auf der Bühne zu sehen, und Hoffmann, um ihnen einen
Vorschmack von dieser Seeligkeit zu geben, mahlte ihnen zum Weihnachtsabend
(1815) mit der größten Sorgfalt, die Burg Ringstetten, bau'te sie ihnen auf,
und erleuchtete sie prachtvoll von innen«. Daß Hoffmann bei solchem Umgang
nicht nur der gebende Teil war, deutet sich im Gespräch der Serapionsbrüder
im Anschluß an die Verlesung des Märchens an, wenn Kinder als anspruchsvolle
Zuhörer, kompetente Kritiker und als Rezipienten vorgestellt werden, die die
phantastische Dichtung als Teil ihres Lebens auffassen. Mit diesen
Eigenschaften sind sie für den Autor auf provozierende und förderliche Weise
'anregend'. E.T.A. Hoffmann: Doppelporträt Julius Eduard Hitzig und seine Frau Eugenie. Berlin 1807. Reproduktion (Original nicht erhalten) Staatsbibliothek Bamberg, E. T. Hoffmann im 7br 1807 Medizinalrat war die Amtsbezeichnung für die entsprechenden technischen Räte der Bezirksregierungen in Preußen. Stahlbaum: Der Familienname ist eine Abwandlung von Thalberg, den Hoffmann in dem Kinderbuch Der Weihnachtsabend in der Familie Thalberg gefunden hat.
|
In diesem reich bebilderten Buch fand Hoffmann die Anregung für seine Erzählung: Geschildert werden die Weihnachtstage einer bürgerlichen Familie, die von einem Onkel besucht wird. In verschiedenen Kapiteln wird der Weihnachtsabend, der mehrfache Besuch eines Weihnachtsmarkts sowie eine Reihe weihnachtlicher Geschichten den Kindern von Onkel und Vater erzählt.
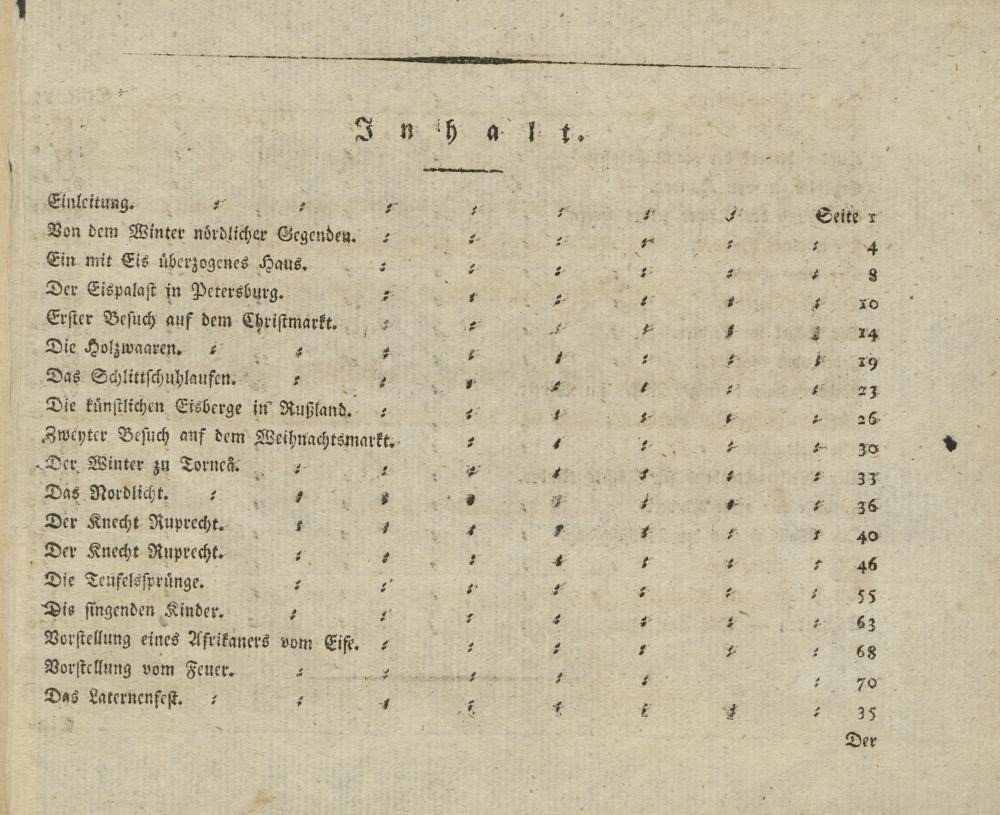
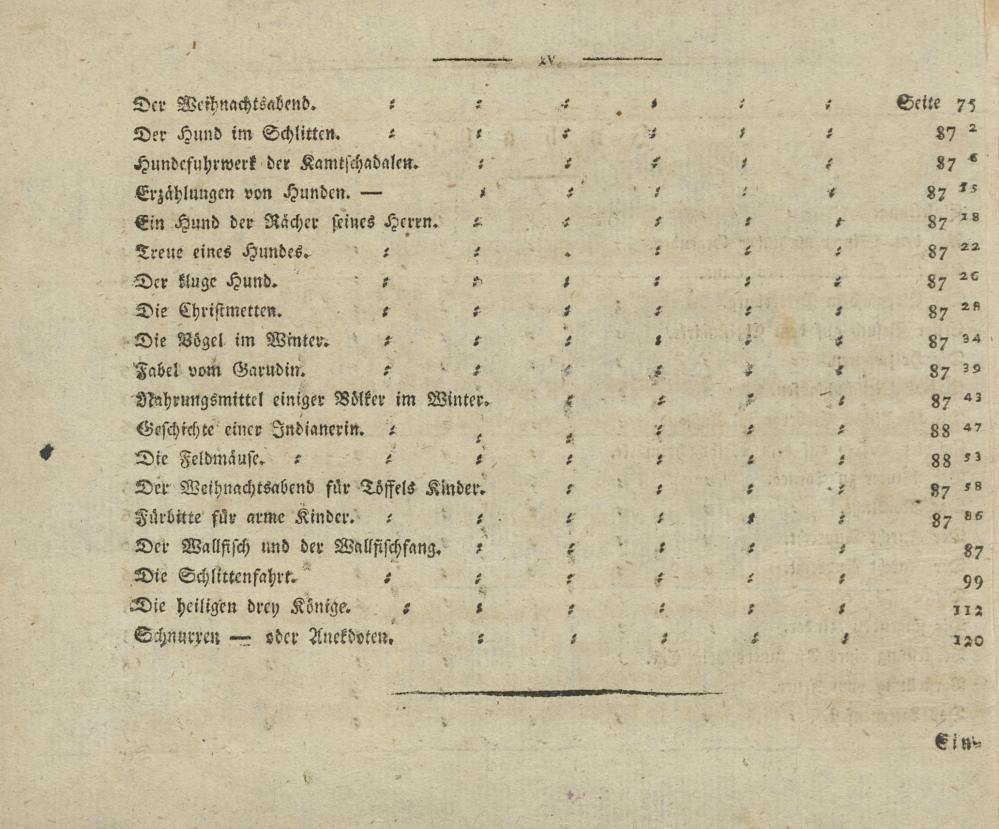
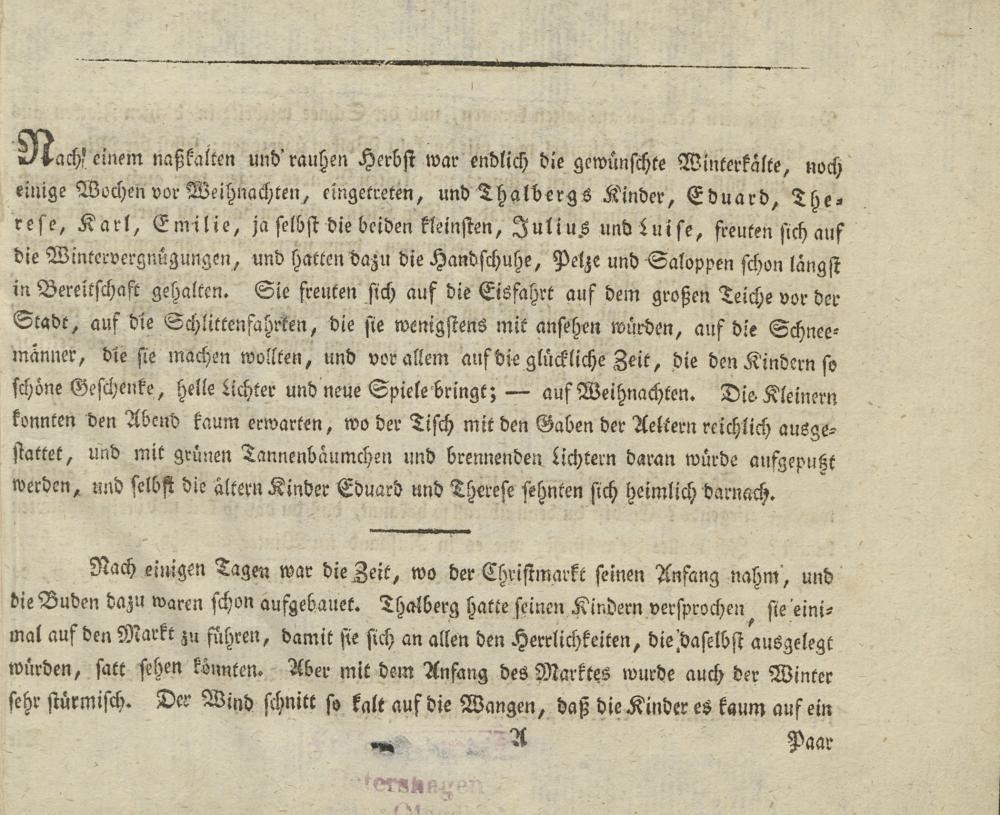

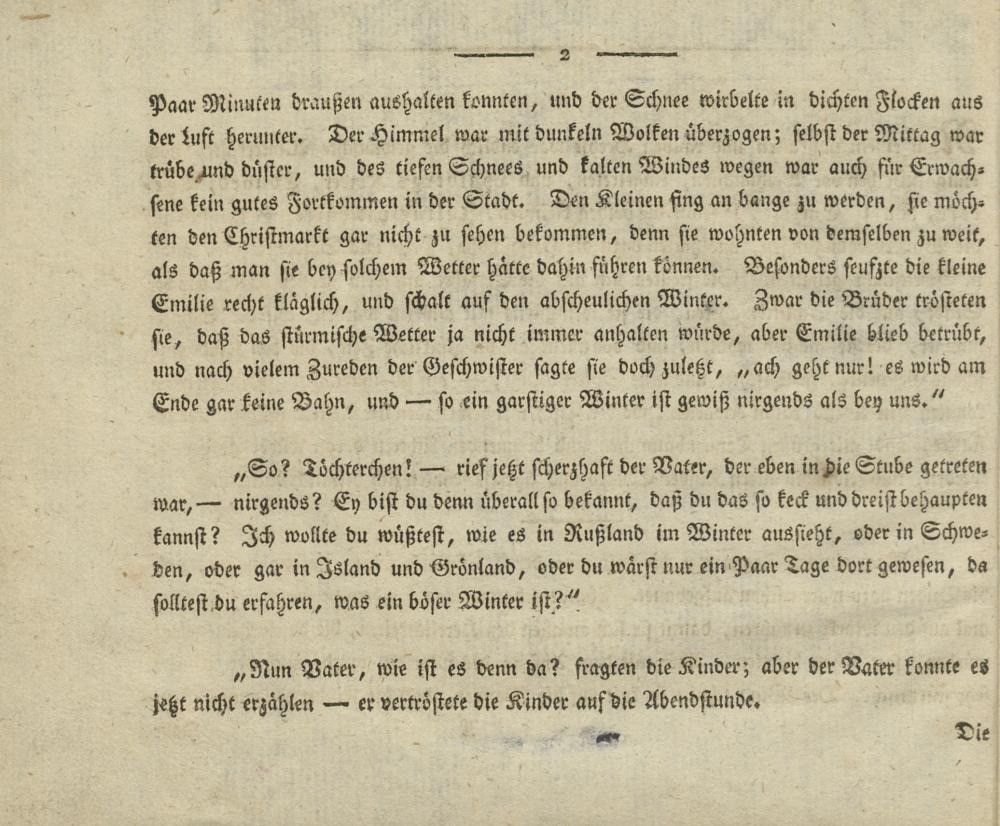
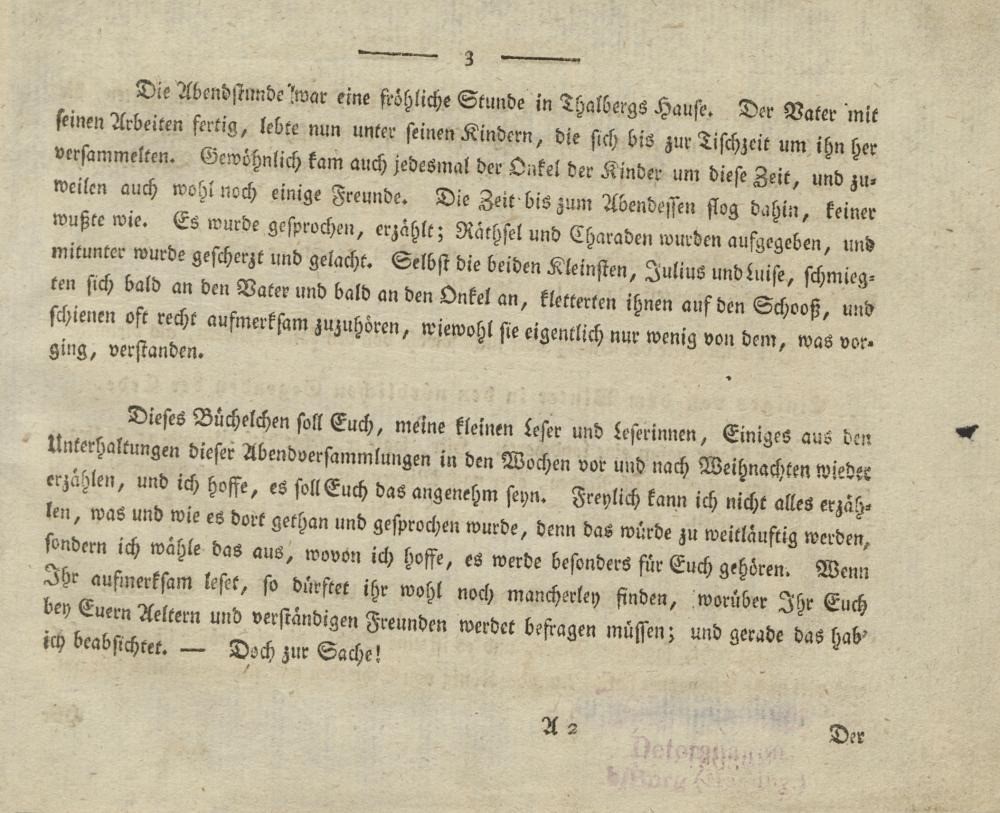
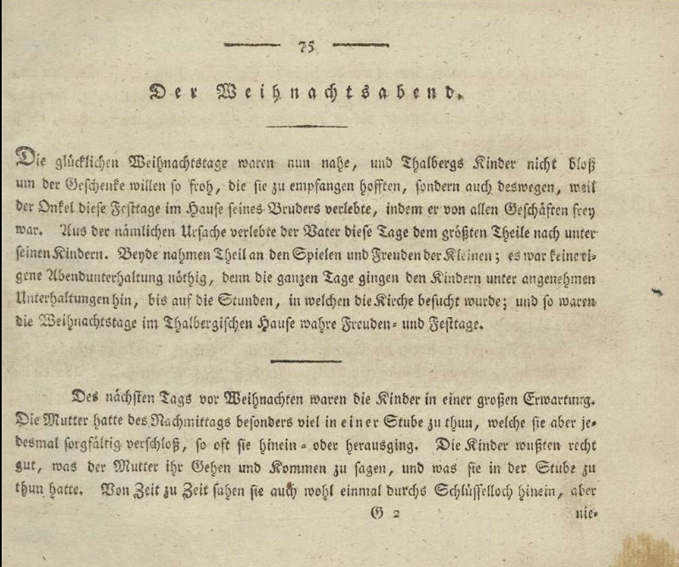
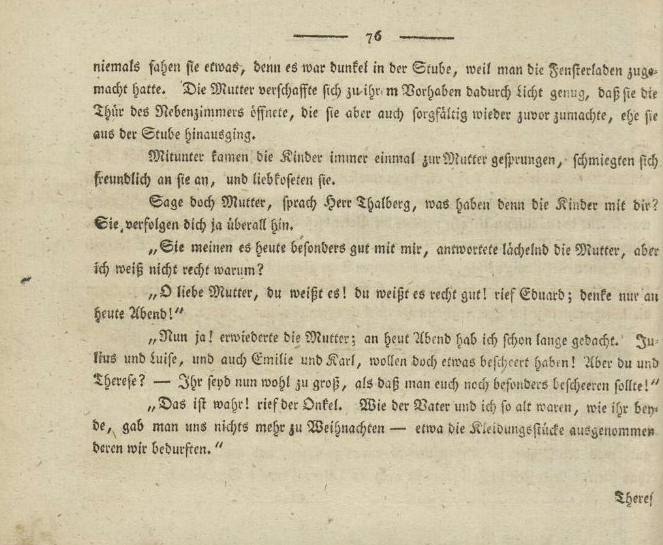
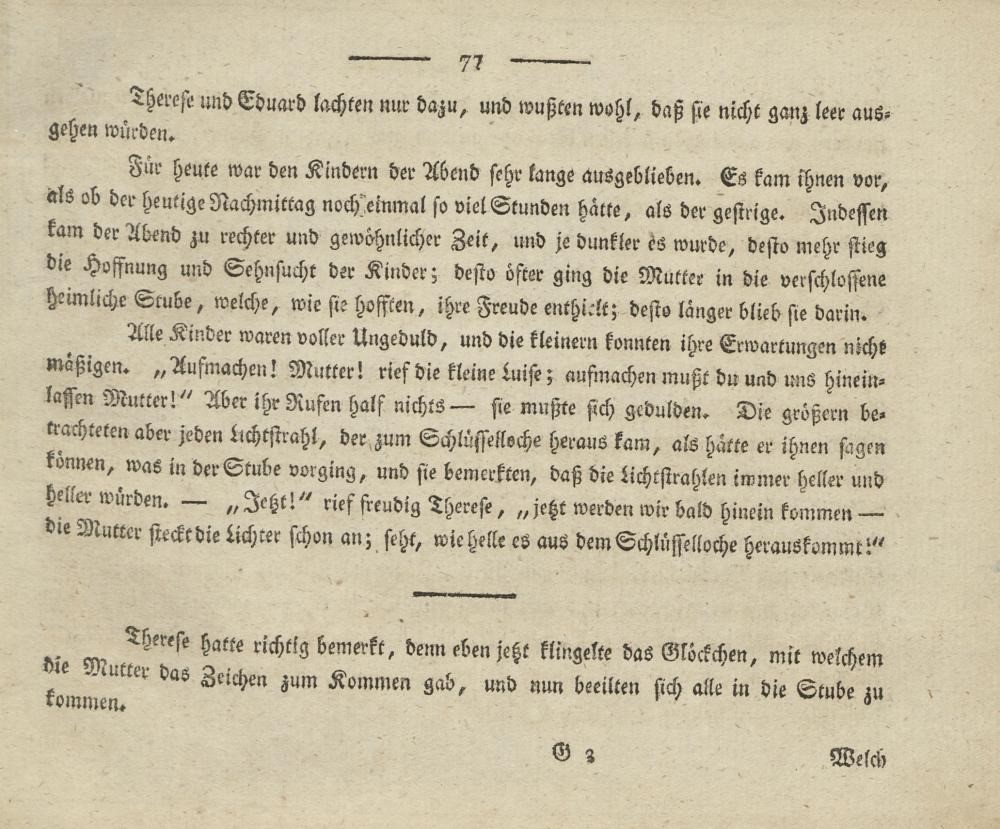
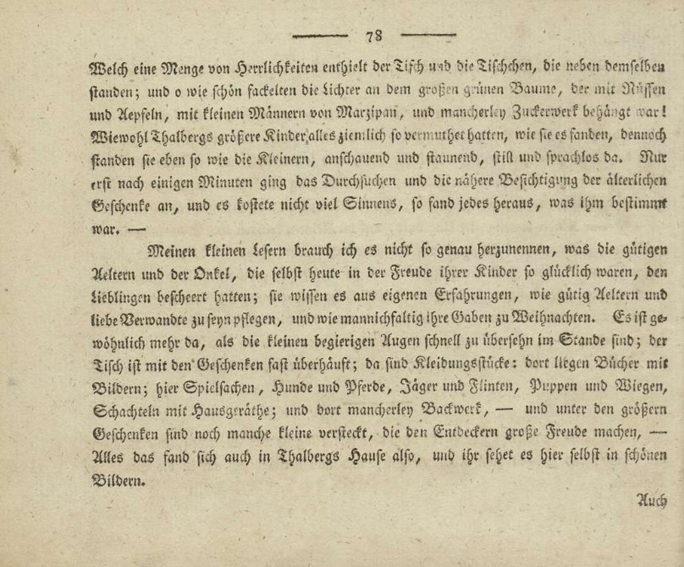
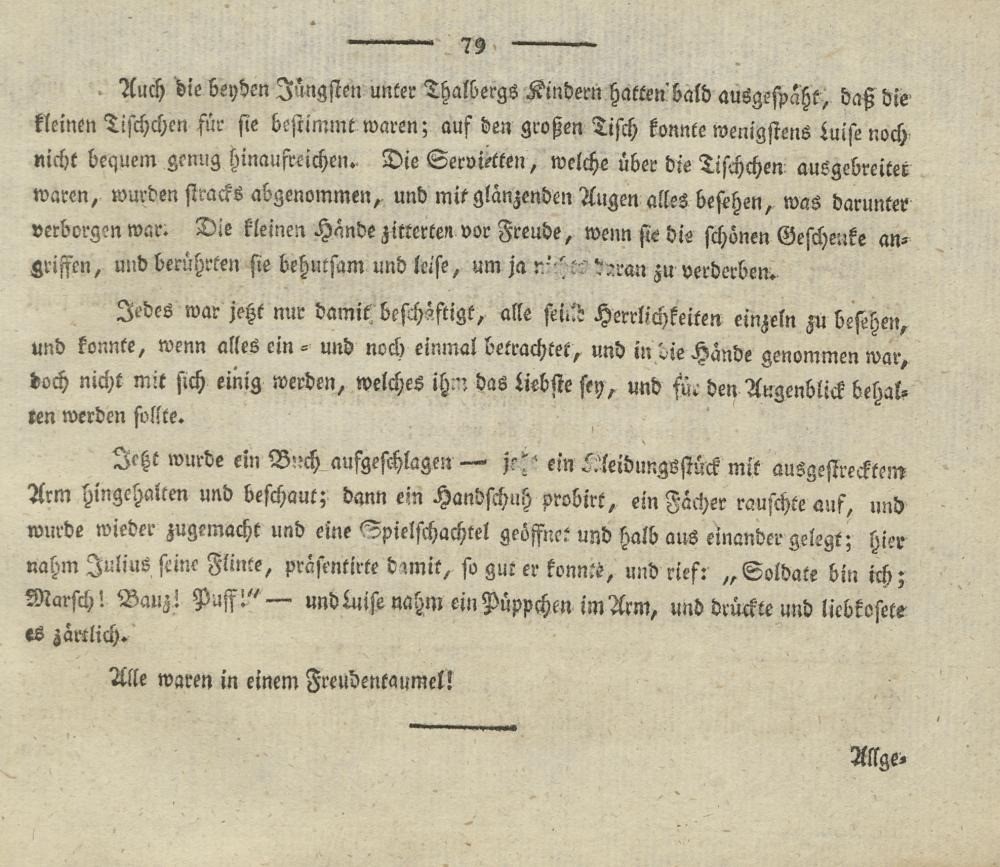

Marie: In Nußknacker und Mausekönig
werden zahlreiche Themen und Aspekte angesprochen: die Beziehung eines
siebenjährigen Mädchens zu seiner Familie, die Spiel- und Phantasiewelt
Maries, die ambivalente Beziehung zwischen Alltagsrealität und Traum sowie
die Belebung von Spielsachen. Außerdem werden mehrere Metamorphosen
dargestellt, Menschen verwandeln sich in Puppen, Spielzeug nimmt menschliche
Gestalt an, die Figuren im Binnenmärchen finden ihren Gegenpart in den
Figuren der Rahmenhandlung, so dass sich nicht nur eine wechselseitige
Spiegelung ergibt, sondern auch die Identität der Figuren in Frage gestellt
wird. Durch den Wechsel zwischen Erzähler- und Figurenrede, die metafiktiven
Leseranreden, die widersprüchlichen Aussagen der Erzählinstanzen und den
Fokalisierungswechsel ergibt sich eine Vieldeutigkeit des Geschehens, die
bis zum Schluss hin anhält und auch keine endgültige Auflösung zulässt. Das
von Hoffmann gewählte Genre, das Kindermärchen, wird darüber hinaus durch
den Autor in seinem Märchencharakter potenziert, indem er das Hauptmärchen
mit einem Binnenmärchen kombiniert.
Bettina Kümmerling-Meibauer 2013
Obergerichtsrat: preußischer Jurist in der
Justizverwaltung. Der
nachweisbare Bezug zu den Kindern des Kriminal- und Pupillenrats Julius
Eduard Hitzig hat viele Kommentatoren zu der weitergehenden Folgerung
veranlaßt, im Paten Droßelmeier habe Hoffmann sich selbst porträtiert. Doch
eine solche Annahme kann sich nur auf wenige Belege stützen, auf Einzelzüge
(wie das Gesichterschneiden Droßelmeiers und seine Häßlichkeit),
Auffassungen und Sichtweisen, die Hoffmanns Figur mit ihrem Urheber teilt;
es handelt sich hier eher um selbstironische Anspielungen als um
autobiographische Bemühungen. Nicht anders verhält es sich mit den (genaugenommen
doch recht wenigen) Hinweisen auf das Berliner Lokalkolorit und den
zeitgeschichtlichen Hintergrund, die Hans von Müller veranlaßt haben, das
Märchen unter seine Zwölf Berlinischen Geschichten (1921)
einzureihen. Gewiß wird niemand die satirischen Züge des Märchens übersehen
wollen, die den Hof und das Hofleben, aber auch das Theater und die
Wissenschaft treffen; aber die Satire berührt die berlinische oder gar
preußische Wirklichkeit nur sehr pauschal und flüchtig, um sich schleunigst
von ihr abzuwenden.
Wulf Segebrecht 2008

E. T. A. Hoffmann, Öl, anonym. Früher als Selbstporträt interpretiert (Alte Nationalgalerie, Berlin)
weiße Perücke:
Perücken (im 17. Jahrhundert entlehnt von französisch perruque
„Haarschopf“), ursprünglich aus echtem Menschenhaar hergestellt, imitieren
eine natürliche Haarpracht, traditionelle oder modische Haartrachten. Sie
werden je nach den traditionellen Sitten oder Riten getragen, aber auch bei
Haarlosigkeit nach der Mode speziell für ihre Träger angefertigt. Weiße
Perücken aus gesponnenen Glasfasern wurden von Richtern und
Militäroffizieren getragen.
Wikipedia
Marstall: Marstall (von althochdeutsch marahstal, zusammengesetzt aus marah Pferd (Mähre) und stal Stall) war ursprünglich eine Bezeichnung für einen Pferdestall eines Fürsten.
Kavallerie: Als Kavallerie oder Reiterei bezeichnet man eine in der Regel zu Pferd kämpfende Waffengattung der Landstreitkräfte.


Neuer Orbis Pictus 1806
der liebe Heilige Christ:
Weihnachten, auch Weihnacht, Christfest oder Heiliger Christ genannt, ist im
Christentum das Fest der Geburt Jesu Christi. Festtag ist der 25. Dezember,
der Christtag, auch Hochfest der Geburt des Herrn (lateinisch Sollemnitas
Nativitatis Domini oder In Nativitate Domini), dessen Feierlichkeiten am
Vorabend, dem Heiligen Abend (auch Heiligabend, Heilige Nacht, Christnacht,
Weihnachtsabend), beginnen.
Bis Ende des 18. Jahrhunderts war Weihnachten in erster Linie ein Fest, das
in den Kirchen und auf den Straßen stattfand (Umzugsbräuche,
Weihnachtsmärkte). Um 1800 kam, regional und konfessionell unterschiedlich,
ein Prozess in Gang, Weihnachten als Anlass zur Festigung von
Familienbeziehungen zu nutzen. Das private Heiligabend-Ritual lässt sich als
cultural performance (Milton Singer) interpretieren. „Die Eltern wirken als
Spielleiter, Organisatoren und Darsteller in der eigenen Inszenierung,
wohingegen Kinder und andere Gäste zugleich als Publikum und Mitspieler
fungieren.“ Das Großbürgertum konnte durch die stilvolle familiäre
Weihnachtsfeier sein Standesbewusstsein festigen, denn die Mehrheit der
Bevölkerung hatte im 19. Jahrhundert nicht die Mittel für eine derartige
Feier und ihre Requisiten, wie den Weihnachtsbaum. Vor allem war ein
Wohnzimmer erforderlich, das hergerichtet wurde, für die Kinder zeitweise
unzugänglich war und dann, verbunden mit dem Einsatz von Lichtern, Düften
und Musik, feierlich betreten wurde. Ingeborg Weber-Kellermann betont, dass
der Heilige Abend erst im Biedermeier zum Beschenkfest für Kinder wurde.
Diese Geschenkbeziehung war einseitig, denn die Gabenbringer Weihnachtsmann
und Christkind konnte man nicht beschenken, und gleichzeitig mit der
Inszenierung der familiären Bescherung kam vielfältiges und neuartiges
Spielzeug auf den Markt.
Wikipedia
Schwester Luise:
Die ältere Schwester Luise nimmt im gesamten Märchen eine marginale Stellung
ein. Ihre wenigen Auftritte lassen jedoch darauf schließen, dass sie von den
jüngeren, kindlichen Geschwistern abzugrenzen und der bürgerlich-prosaischen
Sphäre zuzurechnen ist, wenn sie beispielsweise das ›kindische‹ Verhalten
ihrer jüngeren Geschwister tadelt. Dass sie besonders der Mutter folgt,
zeigt sich, wenn sie ebenfalls in das Gelächter über Maries Berichte
einstimmt. Im Gegensatz zur Mutter wird bei ihr jedoch nicht deutlich, ob
sie sich aus Überzeugung oder Gehorsam den Positionen der Eltern anschließt.
Stefanie Junges: ›Kinder-Märchen‹ in a nutshell? E.T.A. Hoffmanns
Nußknacker und Mausekönig.
Fuchs und Husaren: Fuchs ist eine der drei Grundfarben des Pferdes, neben Braunen und Rappen. Husaren sind eine Truppengattung der leichten Kavallerie.

|
Die Gaben Ich wende mich an dich selbst, sehr geneigter Leser oder Zuhörer Fritz – Theodor – Ernst – oder wie du sonst heißen magst und bitte dich, daß du dir deinen letzten mit schönen bunten Gaben reich geschmückten Weihnachtstisch recht lebhaft vor Augen bringen mögest, dann wirst du es dir wohl auch denken können, wie die Kinder mit glänzenden Augen ganz verstummt stehenblieben, wie erst nach einer Weile Marie mit einem tiefen Seufzer rief – „Ach wie schön – ach wie schön“, und Fritz einige Luftsprünge versuchte, die ihm überaus wohl gerieten. Aber die Kinder mußten auch das ganze Jahr über besonders artig und fromm gewesen sein, denn nie war ihnen so viel Schönes, Herrliches einbeschert worden als dieses Mal. Der große Tannenbaum in der Mitte trug viele goldne und silberne Äpfel, und wie Knospen und Blüten keimten Zuckermandeln und bunte Bonbons und was es sonst noch für schönes Naschwerk gibt, aus allen Ästen. Als das Schönste an dem Wunderbaum mußte aber wohl gerühmt werden, daß in seinen dunkeln Zweigen hundert kleine Lichter wie Sternlein funkelten und er selbst in sich hinein- und herausleuchtend die Kinder freundlich einlud seine Blüten und Früchte zu pflücken. Um den Baum umher glänzte alles sehr bunt und herrlich – was es da alles für schöne Sachen gab – ja, wer das zu beschreiben vermöchte! Marie erblickte die zierlichsten Puppen, allerlei saubere kleine Gerätschaften und was vor allem schön anzusehen war, ein seidenes Kleidchen mit bunten Bändern zierlich geschmückt, hing an einem Gestell so der kleinen Marie vor Augen, daß sie es von allen Seiten betrachten konnte und das tat sie denn auch, indem sie ein Mal über das andere ausrief: „Ach das schöne, ach das liebe – liebe Kleidchen: und das werde ich – ganz gewiß – das werde ich wirklich anziehen dürfen!“ – Fritz hatte indessen schon drei- oder viermal um den Tisch herumgaloppierend und -trabend den neuen Fuchs versucht, den er in der Tat am Tische angezäumt gefunden. Wieder absteigend, meinte er: es sei eine wilde Bestie, das täte aber nichts, er wolle ihn schon kriegen, und musterte die neue Schwadron Husaren, die sehr prächtig in Rot und Gold gekleidet waren, lauter silberne Waffen trugen und auf solchen weißglänzenden Pferden ritten, daß man beinahe hätte glauben sollen, auch diese seien von purem Silber. Eben wollten die Kinder, etwas ruhiger geworden, über die Bilderbücher her, die aufgeschlagen waren, daß man allerlei sehr schöne Blumen und bunte Menschen, ja auch allerliebste spielende Kinder, so natürlich gemalt als lebten und sprächen sie wirklich, gleich anschauen konnte. – Ja! eben wollten die Kinder über diese wunderbaren Bücher her, als nochmals geklingelt wurde. Sie wußten, daß nun der Pate Droßelmeier einbescheren würde, und liefen nach dem an der Wand stehenden Tisch. Schnell wurde der Schirm, hinter dem er so lange versteckt gewesen, weggenommen. Was erblickten da die Kinder! – Auf einem grünen mit bunten Blumen geschmückten Rasenplatz stand ein sehr herrliches Schloß mit vielen Spiegelfenstern und goldnen Türmen. Ein Glockenspiel ließ sich hören, Türen und Fenster gingen auf, und man sah, wie sehr kleine aber zierliche Herrn und Damen mit Federhüten und langen Schleppkleidern in den Sälen herumspazierten. In dem Mittelsaal, der ganz in Feuer zu stehen schien – so viel Lichterchen brannten an silbernen Kronleuchtern – tanzten Kinder in kurzen Wämschen und Röckchen nach dem Glockenspiel. Ein Herr in einem smaragdenen Mantel sah oft durch ein Fenster, winkte heraus und verschwand wieder, so wie auch Pate Droßelmeier selbst, aber kaum viel höher als Papas Daumen zuweilen unten an der Tür des Schlosses stand und wieder hineinging. Fritz hatte mit auf den Tisch gestemmten Armen das schöne Schloß und die tanzenden und spazierenden Figürchen angesehen, dann sprach er: „Pate Droßelmeier! Laß mich mal hineingehen in dein Schloß!“ – Der Obergerichtsrat bedeutete ihn, daß das nun ganz und gar nicht anginge. Er hatte auch recht, denn es war töricht von Fritzen, daß er in ein Schloß gehen wollte, welches überhaupt mitsamt seinen goldnen Türmen nicht so hoch war, als er selbst. Fritz sah das auch ein. Nach einer Weile, als immerfort auf dieselbe Weise die Herrn und Damen hin und her spazierten, die Kinder tanzten, der smaragdne Mann zu demselben Fenster heraussah, Pate Droßelmeier vor die Türe trat, da rief Fritz ungeduldig: „Pate Droßelmeier, nun komm mal zu der andern Tür da drüben heraus.“ „Das geht nicht, liebes Fritzchen“, erwiderte der Obergerichtsrat. „Nun so laß mal“, sprach Fritz weiter, „laß mal den grünen Mann, der so oft herauskuckt, mit den andern herumspazieren.“ „Das geht auch nicht“, erwiderte der Obergerichtsrat aufs neue. „So sollen die Kinder herunterkommen“, rief Fritz, „ich will sie näher besehen.“ „Ei das geht alles nicht“, sprach der Obergerichtsrat verdrießlich, „wie die Mechanik nun einmal gemacht ist, muß sie bleiben.“ „So–o?“ fragte Fritz mit gedehnten Ton, „das geht alles nicht? Hör mal Pate Droßelmeier, wenn deine kleinen geputzten Dinger in dem Schlosse nichts mehr können als immer dasselbe, da taugen sie nicht viel, und ich frage nicht sonderlich nach ihnen. – Nein, da lob ich mir meine Husaren, die müssen manövrieren vorwärts, rückwärts, wie ich's haben will und sind in kein Haus gesperrt.“ Und damit sprang er fort an den Weihnachtstisch und ließ seine Eskadron auf den silbernen Pferden hin und her trottieren und schwenken und einhauen und feuern nach Herzenslust. Auch Marie hatte sich sachte fortgeschlichen, denn auch sie wurde des Herumgehens und Tanzens der Püppchen im Schlosse bald überdrüssig, und mochte es, da sie sehr artig und gut war, nur nicht so merken lassen, wie Bruder Fritz. Der Obergerichtsrat Droßelmeier sprach ziemlich verdrießlich zu den Eltern: „Für unverständige Kinder ist solch künstliches Werk nicht, ich will nur mein Schloß wieder einpacken“; doch die Mutter trat hinzu, und ließ sich den innern Bau und das wunderbare, sehr künstliche Räderwerk zeigen, wodurch die kleinen Püppchen in Bewegung gesetzt wurden. Der Rat nahm alles auseinander, und setzte es wieder zusammen. Dabei war er wieder ganz heiter geworden, und schenkte den Kindern noch einige schöne braune Männer und Frauen mit goldnen Gesichtern, Händen und Beinen. Sie wagen sämtlich aus Thorn, und rochen so süß und angenehm wie Pfefferkuchen, worüber Fritz und Marie sich sehr erfreuten. Schwester Luise hatte, wie es die Mutter gewollt, das schöne Kleid angezogen, welches ihr einbeschert worden, und sah wunderhübsch aus, aber Marie meinte, als sie auch ihr Kleid anziehen sollte, sie möchte es lieber noch ein bißchen so ansehen. Man erlaubte ihr das gern. |
Der Weihnachtsabend in der Familie Thalberg. Kolorierter Kupferstich. den neuen Fuchs: das Geschenk ist ein Steckenpferd. Schwadron Husaren: Kavallerieeinheit
Bilderbücher: Das Bilderbuch für Kinder
war ein enzyklopädisch angelegtes Sach- und Lehrbuch sowie gleichzeitig das
größte Buchprojekt von Friedrich Justin Bertuch (1747–1822), einem
erfolgreichen Verlagsunternehmer der Weimarer Klassik.
Der preußische Pädagoge Friedrich Gedike schrieb 1789: „Keine einzige literarische Manufaktur ist so sehr im Gange, als die Büchermacherei für die Jugend ... Jede Leipziger Sommer- und Wintermesse spült wie die Flut des Meeres eine zahllose Menge Bücher der Art ans Ufer ... alljährlich besonders unter dem für die lieben Eltern und Basen anlockenden Nebentitel ‚Weihnachtsgeschenk für die lieben Kinder’“. Friedrich Justin Bertuch produzierte also für einen großen, aber auch hart umkämpften Markt. Sein Werk wurde nach Umfang und Qualität zum Höhepunkt der Literaturgattung „orbis pictus“. Der Verleger begründete sein Projekt – „Ein Bilderbuch ist für eine Kinderstube ein ebenso wesentliches und noch unentbehrlicheres Meuble als die Wiege, die Puppe oder das Steckenpferd“ – und beschrieb im Vorwort recht ausführlich seine didaktischen Vorstellungen. Dort erklärte er, ein Bilderbuch müsse „schön und richtig gezeichnete und keine schlecht gestochenen Kupfer haben, weil nichts wichtiger ist, als das Auge des Kindes gleich von Anfang an nur an wahre Darstellung der Gegenstände ... zu gewöhnen.“ Und weiter: „Es muss nicht zu viele und zu sehr verschiedene Gegenstände auf einer Tafel zusammendrängen; sonst verwirrt es die Imagination des Kindes und zerstreut seine Aufmerksamkeit.“ „Es muss wenig und nicht gelehrten Text haben; denn das Kind liest und studiert ja sein Bilderbuch nicht, sondern will sich nur damit amüsieren.“ „Es muss, wo möglich, fremde, seltene, jedoch instructive Gegenstände enthalten, die das Kind nicht ohnedieß schon täglich sieht.“
Alle Abbildungen waren jeweils einer von 14 Themengruppen zugeordnet: 1.
Vierfüssige Thiere; 2.Vögel; 3. Fische; 4. Insecten; 5. Pflanzen; 6.
Menschen und Trachten; 7. Gewürme; 8. Conchylien (= Weichtiere); 9. Corallen;
10. Amphibien; 11. Mineralien; 12. Baukunst; 13. Alterthümer; 14. Vermischte
Gegenstände. Naturkundliche Themen hatten erkennbar Vorrang, besonders in
den ersten Jahren. Mit der rasch fortschreitenden technischen Entwicklung
wurden in die Gruppe „Vermischte Gegenstände“ zunehmend auch neuere Objekte
aus diesem Bereich aufgenommen, 1802 etwa der erste Heißluftballon und 1816
das Dampfboot. Die Abfolge der Zeichnungen wirkt oft völlig unsystematisch.
Dazu Bertuch: „... habe ich die krellste und bunteste Mischung der
Gegenstände gewählt und bitte nur immer ... zu bedenken, dass ich es mit
Kindern zu thun habe, die ich blos amüsieren will.“ Auch forderte er die
kindlichen Benutzer auf, die Kupferstiche, soweit sie nicht koloriert waren,
farbig auszumalen, sie auszuschneiden und an die Wand zu hängen.
Neuer Orbis Pictus 1806 |
Pate Droßelmeier: Die wohl schillerndste Figur
des gesamten Märchens ist der Pate Droßelmeier, in dem viele Forscher ein
Alter-Ego Hoffmanns erkennen. Er und sein Neffe, der Nußknacker, sind die
dem magischen Reich zugehörigen Figuren des Textes und besitzen damit duale
Identitäten. Sie verbinden als Figuren die Märchenhandlung mit dem erzählten
Binnenmärchen und sind ursprünglich im Puppenreich verwurzelt.
Der Pate Droßelmeier ist unzweifelhaft eine mysteriöse Figur, die während
des gesamten Handlungsverlaufs nicht eindeutig entschlüsselt wird. Dass der
Pate Droßelmeier jedoch nicht einfach Obergerichtsrat ist, sondern es mit
ihm eine andere Bewandtnis haben muss, wird schnell deutlich. Seine
Identität lässt sich nicht auf die bürgerliche Sphäre begrenzen. Nachdem er
das Märchen von der harten Nuß erzählt hat, ist er – besonders für die
Kinder – nicht nur der kauzige, aber talentierte Pate, sondern ein Arkanist,
der durchaus mit dem Wunderbaren vertraut ist. Die Beschreibungen des Paten
als künstlerischer Mann, der sich auf die Reparatur von Uhren versteht,
korrelieren mit der Beschreibung seines Doppelgängers im Binnenmärchen. Auch
sein unerklärliches Detailwissen sowie sein kurioses Verhalten – z.B. das
Singen des Uhrmacherliedchens – nähren den Verdacht, er bewege sich mit
einer doppelten Identität zwischen den Sphären.
Der Pate hat im Märchen nur wenige Auftritte, ist aber zugleich omnipräsent
und damit als Figur nur schwer zu fassen. Hierin erkennen einige Forscher
die Bestätigung für die These, dass es sich beim Paten um den geheimen
›Spielleiter‹ des Nußknackers handele. Begreift man das Märchen von der
harten Nuß als Vorgeschichte zur Handlung, so lässt sich sogar Droßelmeiers
Status als geheimer Initiator belegen – ein narrativer Kniff, der sich auch
in anderen Texten Hoffmanns findet (z.B. in Die Irrungen/Die Geheimnisse).
Stefanie Junges: ›Kinder-Märchen‹ in a nutshell? E.T.A. Hoffmanns
Nußknacker und Mausekönig.
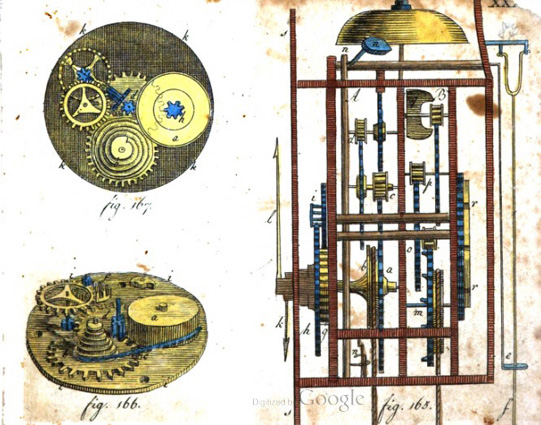 Neuer Orbis Pictus 1806
Neuer Orbis Pictus 1806
Eine
Eskadron (vom französischen Wort für Schwadron)
ist die kleinste taktische Einheit der Kavallerie. Ähnlich wie in den
meisten Ländern betrug in Deutschland ihre Kriegsstärke im 19. Jahrhundert
ca. 150 Pferde und 5 Offiziere.
Wikipedia
|
künstliches Werk: E.T.A. Hoffmann verwendet das Automatenmotiv in vielen seiner Werke, so beispielsweise in „Der Sandmann“ oder „Die Automate“. Er hegte einerseits eine Abneigung gegen die Automaten, andererseits konnte er seine Faszination nicht verstecken. Er informierte sich viel über die Automatenbauer seiner Zeit und besuchte im Herbst 1813 eine Automatensammlung von Johann Friedrich Kaufmann in Dresden. Johann Friedrich Kaufmann lebte von 1785 bis 1866 und ist als Instrumentenbauer bekannt. Besondere Berühmtheit erlangten sein Belloneon, das Harmonichord und der mechanische Trompeter. Letzteren erwähnt auch Hoffmann in seinem Werk „Die Automate“. Es wird ihm sogar nachgesagt, selbst an einigen kleinen Automaten gebaut zu haben. |
Mechanischer Trompeter von
Friedrich Kaufmann, |
|
Der Schützling Eigentlich mochte Marie sich deshalb gar nicht von dem Weihnachtstisch trennen, weil sie eben etwas noch nicht Bemerktes entdeckt hatte. Durch das Ausrücken von Fritzens Husaren, die dicht an dem Baum in Parade gehalten, war nämlich ein sehr vortrefflicher kleiner Mann sichtbar geworden, der still und bescheiden dastand, als erwarte er ruhig, wenn die Reihe an ihn kommen werde. Gegen seinen Wuchs wäre freilich vieles einzuwenden gewesen, denn abgesehen davon, daß der etwas lange, starke Oberleib nicht recht zu den kleinen dünnen Beinchen passen wollte, so schien auch der Kopf bei weitem zu groß. Vieles machte die propre Kleidung gut, welche auf einen Mann von Geschmack und Bildung schließen ließ. Er trug nämlich ein sehr schönes violettglänzendes Husaren-Jäckchen mit vielen weißen Schnüren und Knöpfchen, ebensolche Beinkleider, und die schönsten Stiefelchen, die jemals an die Füße eines Studenten, ja wohl gar eines Offiziers gekommen sind. Sie saßen an den zierlichen Beinchen so knapp angegossen, als wären sie darauf gemalt. Komisch war es zwar, daß er zu dieser Kleidung sich hinten einen schmalen unbeholfenen Mantel, der recht aussah wie von Holz, angehängt, und ein Bergmannsmützchen aufgesetzt hatte, indessen dachte Marie daran, daß Pate Droßelmeier ja auch einen sehr schlechten Matin umhänge, und eine fatale Mütze aufsetze, dabei aber doch ein gar lieber Pate sei. Auch stellte Marie die Betrachtung an, daß Pate Droßelmeier, trüge er sich auch übrigens so zierlich wie der Kleine, doch nicht einmal so hübsch als er aussehen werde. Indem Marie den netten Mann, den sie auf den ersten Blick liebgewonnen, immer mehr und mehr ansah, da wurde sie erst recht inne, welche Gutmütigkeit auf seinem Gesichte lag. Aus den hellgrünen, etwas zu großen hervorstehenden Augen sprach nichts als Freundschaft und Wohlwollen. Es stand dem Manne gut, daß sich um sein Kinn ein wohlfrisierter Bart von weißer Baumwolle legte, denn um so mehr konnte man das süße Lächeln des hochroten Mundes bemerken. “Ach!“ rief Marie endlich aus: „ach lieber Vater, wem gehört denn der allerliebste kleine Mann dort am Baum?“ „Der“, antwortete der Vater, „der, liebes Kind! soll für euch alle tüchtig arbeiten, er soll euch fein die harten Nüsse aufreißen, und er gehört Luisen ebensogut, als dir und dem Fritz.“ Damit nahm ihn der Vater behutsam vom Tische, und indem er den hölzernen Mantel in die Höhe hob, sperrte das Männlein den Mund weit, weit auf, und zeigte zwei Reihen sehr weißer spitzer Zähnchen. Marie schob auf des Vaters Geheiß eine Nuß hinein, und – knack – hatte sie der Mann zerrissen, daß die Schalen abfielen, und Marie den süßen Kern in die Hand bekam. Nun mußte wohl jeder und auch Marie wissen, daß der zierliche kleine Mann aus dem Geschlecht der Nußknacker abstammte, und die Profession seiner Vorfahren trieb. Sie jauchzte auf vor Freude, da sprach der Vater: „Da dir, liebe Marie, Freund Nußknacker so sehr gefällt, so sollst du ihn auch besonders hüten und schützen, unerachtet, wie ich gesagt, Luise und Fritz ihn mit ebenso vielem Recht brauchen können als du!“ – Marie nahm ihn sogleich in den Arm, und ließ ihn Nüsse aufknacken, doch suchte sie die kleinsten aus, damit das Männlein nicht so weit den Mund aufsperren durfte, welches ihm doch im Grunde nicht gut stand. Luise gesellte sich zu ihr, und auch für sie mußte Freund Nußknacker seine Dienste verrichten, welches er gern zu tun schien, da er immerfort sehr freundlich lächelte. Fritz war unterdessen vom vielen Exerzieren und Reiten müde geworden, und da er so lustig Nüsse knacken hörte, sprang er hin zu den Schwestern, und lachte recht von Herzen über den kleinen drolligen Mann, der nun, da Fritz auch Nüsse essen wollte, von Hand zu Hand ging, und gar nicht aufhören konnte mit Auf- und Zuschnappen. Fritz schob immer die größten und härtsten Nüsse hinein, aber mit einem Male ging es – krack – krack – und drei Zähnchen fielen aus des Nußknackers Munde, und sein ganzes Unterkinn war lose und wacklicht. – „Ach mein armer lieber Nußknacker!“ schrie Marie laut, und nahm ihn dem Fritz aus den Händen. „Das ist ein einfältiger dummer Bursche“, sprach Fritz. „Will Nußknacker sein, und hat kein ordentliches Gebiß – mag wohl auch sein Handwerk gar nicht verstehn. – Gib ihn nur her, Marie! Er soll mir Nüsse zerreißen, verliert er auch noch die übrigen Zähne, ja das ganze Kinn obendrein, was ist an dem Taugenichts gelegen.“ „Nein, nein“, rief Marie weinend, „du bekommst ihn nicht, meinen lieben Nußknacker, sieh nur her, wie er mich so wehmütig anschaut, und mir sein wundes Mündchen zeigt! – Aber du bist ein hartherziger Mensch – Du schlägst deine Pferde, und läßt wohl gar einen Soldaten totschießen.“ – „Das muß so sein, das verstehst du nicht“, rief Fritz; „aber der Nußknacker gehört ebensogut mir, als dir, gib ihn nur her.“ – Marie fing an heftig zu weinen, und wickelte den kranken Nußknacker schnell in ihr kleines Taschentuch ein. Die Eltern kamen mit dem Paten Droßelmeier herbei. Dieser nahm zu Mariens Leidwesen Fritzens Partie. Der Vater sagte aber: „Ich habe den Nußknacker ausdrücklich unter Mariens Schutz gestellt, und da, wie ich sehe, er dessen eben jetzt bedarf, so hat sie volle Macht über ihn, ohne daß jemand dreinzureden hat. Übrigens wundert es mich sehr von Fritzen, daß er von einem im Dienst Erkrankten noch fernere Dienste verlangt. Als guter Militär sollte er doch wohl wissen, daß man Verwundete niemals in Reihe und Glied stellt?“ – Fritz war sehr beschämt, und schlich, ohne sich weiter um Nüsse und Nußknacker zu bekümmern, fort an die andere Seite des Tisches, wo seine Husaren, nachdem sie gehörige Vorposten ausgestellt hatten, ins Nachtquartier gezogen waren. Marie suchte Nußknackers verlorne Zähnchen zusammen, um das kranke Kinn hatte sie ein hübsches weißes Band, das sie von ihrem Kleidchen abgelöst, gebunden, und dann den armen Kleinen, der sehr blaß und erschrocken aussah, noch sorgfältiger als vorher in ihr Tuch eingewickelt. So hielt sie ihn wie ein kleines Kind wiegend in den Armen, und besah die schönen Bilder des neuen Bilderbuchs, das heute unter den andern vielen Gaben lag. Sie wurde, wie es sonst gar nicht ihre Art war, recht böse, als Pate Droßelmeier so sehr lachte, und immerfort fragte: wie sie denn mit solch einem grundhäßlichen kleinen Kerl so schöntun könne? – Jener sonderbare Vergleich mit Droßelmeier, den sie anstellte, als der Kleine ihr zuerst in die Augen fiel, kam ihr wieder in den Sinn, und sie sprach sehr ernst: „Wer weiß, lieber Pate, ob du denn, putzest du dich auch so heraus wie mein lieber Nußknacker, und hättest du auch solche schöne blanke Stiefelchen an, wer weiß, ob du denn doch so hübsch aussehen würdest, als er!“ – Marie wußte gar nicht, warum denn die Eltern so laut auflachten, und warum der Obergerichtsrat solch eine rote Nase bekam, und gar nicht so hell mitlachte, wie zuvor. Es mochte wohl seine besondere Ursache haben. |
Der Weihnachtsabend in der Familie Thalberg. Kolorierter Kupferstich. aus Thorn: Thorner Lebkuchen oder Thorner Honigkuchen sind Lebkuchen, die nach ihrer Herkunftsstadt Thorn in Preußen (polnisch Toruń, heute in Polen) benannt sind. Sie blicken auf eine jahrhundertealte Tradition zurück, deren erste Anfänge im 13. Jahrhundert liegen, als Thorn zum Deutschordensstaat gehörte. Das Thorner Lebkuchenhandwerk wurde 1380 erstmals erwähnt, bestand aber vermutlich seit dem 13. Jahrhundert. Mit Johann Weese fing 1763 in Thorn ein Betrieb an, der unter Gustav Weese in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts 500 Leute beschäftigte.
Thorner Lebkuchen gibt es in vielfältigen
Formen, die zum Teil anlassbezogen variieren können. Sehr beliebt waren zu
Weihnachten Thorner Figurenlebkuchen – aufwändig gestaltete und teils sehr
große Gebildbrote, unter anderem in Form von Rats- und Edelherren, Kutschen,
Wappen, Mauern und Türmen oder mit aufgeprägten Bildern. Ein Nussknacker wird auch in dem Kinderbuch Der Weihnachtsabend in der Familie Thalberg erwähnt. Das ist ein Nußknacker, antwortete der Onkel. Da er bessere Zähne hat, als ich, so muß er mir die Nüsse aufbeißen. Emilie hielt das bloß für Spaß. Nun fuhr der Onkel fort, da sollst du es gleich sehen. Der Onkel holte den breitmäuligen Kerl aus der Tasche, und brachte zum Erstaunen der Kinder zugleich ein hübsch volles Säckchen Haselnüsse heraus. Das breite Maul der Figur öffnete sich so weit, daß das Kinn bis an den Magen reichte, eine Nuß wurde hineingelegt; das Maul schloß sich wieder und die aufgeknackten Nüßchen aßen die Kinder selbst. Nußknacker und Nüsse blieben ein Eigenthum der Kinder, denn der Onkel schenkte ihnne beydes.
|
Wie der Pate hat auch der Nußknacker eine
duale Identität. Zum einen ist er der verzauberte Nußknacker, der am
Weihnachtsabend unter Maries Schutz gestellt wird. Zum anderen ist er der
Neffe Droßelmeiers und, so verdeutlicht es das Ende des Märchens, sogar der
Prinz des Puppenreichs. Sein Wesen ist, abgesehen von der Doppelexistenz,
durch die er zwei Weltsphären angehört, homogen und harmonisch. Er ist ein
galanter Jüngling, der Marie stets seine Treue beweist und der, außer seiner
Verzauberung, keine ambivalenten Charakterzüge aufweist. Obwohl er als Neffe
aus Nürnberg aus der bürgerlichen Sphäre zu stammen scheint, gehört er als
Prinz des Puppenreichs der Welt des Wunderbaren an. Jedoch geht mit dieser
doppelten Verankerung in zwei Welten und der doppelten Identität kein
›psychischer Dualismus‹ einher. Der Nußknacker stellt für Marie den Zugang
zu dieser Welt dar und ist scheinbar die einzige Figur, die die Welten ohne
Hilfe in beide Richtungen übertreten kann. Nicht nur, dass er damit als
einziger uneingeschränkten Zugang zu beiden Welten hat, er wird dadurch zum
Knotenpunkt für Paratexte, Binnenmärchen und die eigentliche
Märchenhandlung. Dennoch bleibt er als Figur vergleichsweise flach.
Stefanie Junges: ›Kinder-Märchen‹ in a nutshell? E.T.A. Hoffmanns
Nußknacker und Mausekönig.

Matin: weiter Umhang
Fritz war sehr beschämt: Die Eltern zeigen
einen überaus liebevollen, aber durchaus auch maßregelnden Umgang mit ihren
Kindern. Dies zeigt sich beispielsweise, als Marie den Vater fragt, wem der
Nußknacker gehöre. Der Vater teilt mit, dass es ein gemeinschaftliches
Geschenk für die Kinder sei, nimmt ihn »behutsam vom Tische«, zeigt Marie,
wie er zu benutzen ist, und überträgt ihr die Verantwortung für das neue
Geschenk. Als Fritz den Nußknacker jedoch beschädigt, greift der Vater zu
einer erzieherischen Maßnahme: Er beschämt seinen Sohn, indem er ihn
ermahnt, »als guter Militair sollte er doch wohl wissen, daß man Verwundete
niemals in Reihe und Glied stellt«. Als Vertreter einer auf Verstand
fußenden Gesellschaftsschicht empfindet er Maries ›Gerede‹ über das
Puppenreich und den verwunschenen Nußknacker als das Produkt ihrer regen
Phantasie und versucht, seine Tochter durch das Androhen von Sanktionen
wieder zur Vernunft zu bringen.
Stefanie Junges: ›Kinder-Märchen‹ in a nutshell? E.T.A. Hoffmanns
Nußknacker und Mausekönig.

Die
Geschichte gibt erlebte Welt der kleinen Marie wieder. Am Anfang zeigt sich
diese Welt noch als ein Teil des gesamten kindlichen Raumes, der zusammen
mit dem von Fritz einen Gegensatz zu der Welt der Erwachsenen bildet.
Allerdings schon in der Anfangsphase des Erzählens zeigt sich die Kinderwelt
als dissonant. Die Kinder, Marie und Fritz, erzählen sich gegenseitig noch
kurz vor der Weihnachtbescherung ihre Erwartungen und Wünsche. Ihre Träume
und Weltverständnis gehen wesentlich auseinander. Aufgrund ihres Gesprächs
lassen sich zwei stark differenzierte Denkweisen, Denkkonzepte
unterscheiden. Der Junge zeigt sich im Vergleich zu Marie als pragmatisch,
ohne größeren Hang zur Phantasie und Romantik. Seine Spiele mit
Spielsoldaten ahmen eigentlich nur reale Geschehnisse nach. Daher beziehen
sich auch seine Bescherungswünsche nur auf Bedürfnisse, die mit Realität
zusammenhängen. Er schätzt richtig ab, dass er mit einem Pferd und einer
Kavallerie beschenkt werden wird, weil es den realen Umständen entspricht,
dass ein Marschall ein Pferd besitzen muss und „das sei dem Papa recht gut
bekannt“. Durch diese Bemerkung verschafft er sich Rechtfertigung für seinen
Wunsch und gleichzeitig schließt er sich dem männlichen Denkensmuster an.
Demzufolge kann er nicht der phantasievollen, verbalen Malerei seiner
Schwester folgen und bricht sie mit seinem durch reale Umstände motivierten
Einwand ab „Schwäne fressen keinen Marzipan“. Die im Märchen geschilderten
Vorlieben und Neigungen der Kinder sind geschlechtsspezifisch und beruhen
aus heutiger Sicht auf traditionellen Vorstellungen über Männlichkeit und
Weiblichkeit. In diesem Sinne umgibt sich Fritz mit Spielsoldaten und wird
dadurch manchmal auch hartherzig und rau. Marie wird dagegen als taktvolles
und mitfühlendes Mädchen dargestellt, die mit Puppen spielt, bis auf den
Exzess mit dem Nußknacker, der aber gerade wegen Nußknackers Geschlechts
symptomatisch ist.
Olga Buchtíková 2015, S. 31.
|
Wunderdinge Bei Medizinalrats in der Wohnstube, wenn man zur Türe hineintritt gleich links an der breiten Wand steht ein hoher Glasschrank, in welchem die Kinder all die schönen Sachen, die ihnen jedes Jahr einbeschert worden, aufbewahren. Die Luise war noch ganz klein, als der Vater den Schrank von einem sehr geschickten Tischler machen ließ, der so himmelhelle Scheiben einsetzte, und überhaupt das Ganze so geschickt einzurichten wußte, daß alles drinnen sich beinahe blanker und hübscher ausnahm, als wenn man es in Händen hatte. Im obersten Fache, für Marien und Fritzen unerreichbar, standen des Paten Droßelmeier Kunstwerke, gleich darunter war das Fach für die Bilderbücher, die beiden untersten Fächer durften Marie und Fritz anfüllen wie sie wollten, jedoch geschah es immer, daß Marie das unterste Fach ihren Puppen zur Wohnung einräumte, Fritz dagegen in dem Fache drüber seine Truppen Kantonierungsquartiere beziehen ließ. So war es auch heute gekommen, denn, indem Fritz seine Husaren oben aufgestellt, hatte Marie unten Mamsell Trutchen beiseite gelegt, die neue schön geputzte Puppe in das sehr gut möblierte Zimmer hineingesetzt, und sich auf Zuckerwerk bei ihr eingeladen. Sehr gut möbliert war das Zimmer, habe ich gesagt, und das ist auch wahr, denn ich weiß nicht, ob du, meine aufmerksame Zuhörerin Marie! ebenso wie die kleine Stahlbaum (es ist dir schon bekannt worden, daß sie auch Marie heißt), ja! – ich meine, ob du ebenso wie diese, ein kleines schöngeblümtes Sofa, mehrere allerliebste Stühlchen, einen niedlichen Teetisch, vor allen Dingen aber ein sehr nettes blankes Bettchen besitzest, worin die schönsten Puppen ausruhen? Alles dieses stand in der Ecke des Schranks, dessen Wände hier sogar mit bunten Bilderchen tapeziert waren, und du kannst dir wohl denken, daß in diesem Zimmer die neue Puppe, welche, wie Marie noch denselben Abend erfuhr, Mamsell Clärchen hieß, sich sehr wohl befinden mußte. Es war später Abend geworden, ja Mitternacht im Anzuge, und Pate Droßelmeier längst fortgegangen, als die Kinder noch gar nicht wegkommen konnten von dem Glasschrank, so sehr auch die Mutter mahnte, daß sie doch endlich nun zu Bette gehen möchten. „Es ist wahr“, rief endlich Fritz, „die armen Kerls“ (seine Husaren meinend) „wollen auch nun Ruhe haben, und solange ich da bin, wagt's keiner, ein bißchen zu nicken, das weiß ich schon!“ Damit ging er ab; Marie aber bat gar sehr: „Nur noch ein Weilchen, ein einziges kleines Weilchen laß mich hier, liebe Mutter, hab ich ja doch manches zu besorgen, und ist das geschehen, so will ich ja gleich zu Bette gehen!“ Marie war gar ein frommes vernünftiges Kind, und so konnte die gute Mutter wohl ohne Sorgen sie noch bei den Spielsachen allein lassen. Damit aber Marie nicht etwa gar zu sehr verlockt werde von der neuen Puppe und den schönen Spielsachen überhaupt, so aber die Lichter vergäße, die rings um den Wandschrank brennten, löschte die Mutter sie sämtlich aus, so daß nur die Lampe, die in der Mitte des Zimmers von der Decke herabhing, ein sanftes anmutiges Licht verbreitete. „Komm bald hinein, liebe Marie! sonst kannst du ja morgen nicht zu rechter Zeit aufstehen“, rief die Mutter, indem sie sich in das Schlafzimmer entfernte. Sobald sich Marie allein befand, schritt sie schnell dazu, was ihr zu tun recht auf dem Herzen lag, und was sie doch nicht, selbst wußte sie nicht warum, der Mutter zu entdecken vermochte. Noch immer hatte sie den kranken Nußknacker eingewickelt in ihr Taschentuch auf dem Arm getragen. Jetzt legte sie ihn behutsam auf den Tisch, wickelte leise, leise das Tuch ab, und sah nach den Wunden. Nußknacker war sehr bleich, aber dabei lächelte er so sehr wehmütig freundlich, daß es Marien recht durch das Herz ging. „Ach, Nußknackerchen“, sprach sie sehr leise, „sei nur nicht böse, daß Bruder Fritz dir so wehe getan hat, er hat es auch nicht so schlimm gemeint, er ist nur ein bißchen hartherzig geworden durch das wilde Soldatenwesen, aber sonst ein recht guter Junge, das kann ich dich versichern. Nun will ich dich aber auch recht sorglich so lange pflegen, bis du wieder ganz gesund und fröhlich geworden; dir deine Zähnchen recht fest einsetzen, dir die Schultern einrenken, das soll Pate Droßelmeier, der sich auf solche Dinge versteht.“ – Aber nicht ausreden konnte Marie, denn indem sie den Namen Droßelmeier nannte, machte Freund Nußknacker ein ganz verdammt schiefes Maul, und aus seinen Augen fuhr es heraus, wie grünfunkelnde Stacheln. In dem Augenblick aber, daß Marie sich recht entsetzen wollte, war es ja wieder des ehrlichen Nußknackers wehmütig lächelndes Gesicht, welches sie anblickte, und sie wußte nun wohl, daß der von der Zugluft berührte, schnell auflodernde Strahl der Lampe im Zimmer Nußknackers Gesicht so entstellt hatte. „Bin ich nicht ein töricht Mädchen, daß ich so leicht erschrecke, so daß ich sogar glaube, das Holzpüppchen da könne mir Gesichter schneiden! Aber lieb ist mir doch Nußknacker gar zu sehr, weil er so komisch ist, und doch so gutmütig, und darum muß er gepflegt werden, wie sich's gehört!“ Damit nahm Marie den Freund Nußknacker in den Arm, näherte sich dem Glasschrank, kauerte vor dem selben, und sprach also zur neuen Puppe: „Ich bitte dich recht sehr, Mamsell Clärchen, tritt dein Bettchen dem kranken wunden Nußknacker ab, und behelfe dich, so gut wie es geht, mit dem Sofa. Bedenke, daß du sehr gesund, und recht bei Kräften bist, denn sonst würdest du nicht solche dicke dunkelrote Backen haben, und daß sehr wenige der allerschönsten Puppen solche weiche Sofas besitzen.“ Mamsell Clärchen sah in vollem glänzenden Weihnachtsputz sehr vornehm und verdrießlich aus, und sagte nicht „Muck!“ „Was mache ich aber auch für Umstände“, sprach Marie, nahm das Bette hervor, legte sehr leise und sanft Nußknackerchen hinein, wickelte noch ein gar schönes Bändchen, das sie sonst um den Leib getragen, um die wunden Schultern, und bedeckte ihn bis unter die Nase. „Bei der unartigen Cläre darf er aber nicht bleiben“, sprach sie weiter, und hob das Bettchen samt dem darinne liegenden Nußknacker heraus in das obere Fach, so daß es dicht neben dem schönen Dorf zu stehen kam, wo Fritzens Husaren kantonierten. Sie verschloß den Schrank und wollte ins Schlafzimmer, da – horcht auf Kinder! – da fing es an leise – leise zu wispern und zu flüstern und zu rascheln ringsherum, hinter dem Ofen, hinter den Stühlen, hinter den Schränken. – Die Wanduhr schnurrte dazwischen lauter und lauter, aber sie konnte nicht schlagen. Marie blickte hin, da hatte die große vergoldete Eule, die darauf saß, ihre Flügel herabgesenkt, so daß sie die ganze Uhr überdeckten und den häßlichen Katzenkopf mit krummen Schnabel weit vorgestreckt. Und stärker schnurrte es mit vernehmlichen Worten: „Uhr, Uhre, Uhre, Uhren, müßt alle nur leise schnurren, leise schnurren. – Mausekönig hat jawohl ein feines Ohr – purrpurr – pum pum singt nur, singt ihm altes Liedlein vor – purr purr – pum pum schlag an Glöcklein, schlag an, bald ist es um ihn getan!“ Und pum pum ging es ganz dumpf und heiser zwölfmal! – Marien fing an sehr zu grauen, und entsetzt wär sie beinahe davongelaufen, als sie Pate Droßelmeier erblickte, der statt der Eule auf der Wanduhr saß und seine gelben Rockschöße von beiden Seiten wie Flügel herabgehängt hatte, aber sie ermannte sich und rief laut und weinerlich: „Pate Droßelmeier, Pate Droßelmeier, was willst du da oben? Komm herunter zu mir und erschrecke mich nicht so, du böser Pate Droßelmeier!“ – Aber da ging ein tolles Kichern und Gepfeife los rundumher, und bald trottierte und lief es hinter den Wänden wie mit tausend kleinen Füßchen und tausend kleine Lichterchen blickten aus den Ritzen der Dielen. Aber nicht Lichterchen waren es, nein! kleine funkelnde Augen, und Marie wurde gewahr, daß überall Mäuse hervorguckten und sich hervorarbeiteten. Bald ging es trott – trott – hopp hopp in der Stube umher – immer lichtere und dichtere Haufen Mäuse galoppierten hin und her, und stellten sich endlich in Reihe und Glied, so wie Fritz seine Soldaten zu stellen pflegte, wenn es zur Schlacht gehen sollte. Das kam nun Marien sehr possierlich vor, und da sie nicht, wie manche andere Kinder, einen natürlichen Abscheu gegen Mäuse hatte, wollte ihr eben alles Grauen vergehen, als es mit einemmal so entsetzlich und so schneidend zu pfeifen begann, daß es ihr eiskalt über den Rücken lief! – Ach was erblickte sie jetzt! – Nein, wahrhaftig, geehrter Leser Fritz, ich weiß, daß ebensogut wie dem weisen und mutigen Feldherrn Fritz Stahlbaum dir das Herz auf dem rechten Flecke sitzt, aber, hättest du das gesehen, was Marien jetzt vor Augen kam, wahrhaftig du wärst davongelaufen, ich glaube sogar, du wärst schnell ins Bett gesprungen und hättest die Decke viel weiter über die Ohren gezogen als gerade nötig. – Ach! – das konnte die arme Marie ja nicht einmal tun, denn hört nur Kinder! – dicht dicht vor ihren Füßen sprühte es wie von unterirdischer Gewalt getrieben, Sand und Kalk und zerbröckelte Mauersteine hervor und sieben Mäuseköpfe mit sieben hellfunkelnden Kronen erhoben sich recht gräßlich zischend und pfeifend aus dem Boden. Bald arbeitete sich auch der Mausekörper, an dessen Hals die sieben Köpfe angewachsen waren, vollends hervor und der großen mit sieben Diademen geschmückten Maus jauchzte in vollem Chorus dreimal laut aufquiekend das ganze Heer entgegen, das sich nun auf einmal in Bewegung setzte und hott, hott – trott – trott ging es – ach geradezu auf den Schrank – geradezu auf Marien los, die noch dicht an der Glastüre des Schrankes stand. Vor Angst und Grauen hatte Marien das Herz schon so gepocht, daß sie glaubte, es müsse nun gleich aus der Brust herausspringen und dann müßte sie sterben; aber nun war es ihr, als stehe ihr das Blut in den Adern still. Halb ohnmächtig wankte sie zurück, da ging es klirr – klirr – prr und in Scherben fiel die Glasscheibe des Schranks herab, die sie mit dem Ellbogen eingestoßen. Sie fühlte wohl in dem Augenblick einen recht stechenden Schmerz am linken Arm, aber es war ihr auch plötzlich viel leichter ums Herz, sie hörte kein Quieken und Pfeifen mehr, es war alles ganz still geworden, und, obschon sie nicht hinblicken mochte, glaubte sie doch, die Mäuse wären von dem Klirren der Scheibe erschreckt wieder abgezogen in ihre Löcher. – Aber was war denn das wieder? – Dicht hinter Marien fing es an im Schrank auf seltsame Weise zu rumoren und ganz feine Stimmchen fingen an: „Aufgewacht – aufgewacht – wolln zur Schlacht – noch diese Nacht – aufgewacht – auf zur Schlacht.“ – Und dabei klingelte es mit harmonischen Glöcklein gar hübsch und anmutig! „Ach das ist ja mein kleines Glockenspiel“, rief Marie freudig, und sprang schnell zur Seite. Da sah sie wie es im Schrank ganz sonderbar leuchtete und herumwirtschaftete und hantierte. Es waren mehrere Puppen, die durcheinanderliefen und mit den kleinen Armen herumfochten. Mit einemmal erhob sich jetzt Nußknacker, warf die Decke weit von sich und sprang mit beiden Füßen zugleich aus dem Bette, indem er laut rief: „Knack – knack – knack – dummes Mausepack – dummer toller Schnack – Mausepack – Knack – Knack – Mausepack – Krick und Krack – wahrer Schnack.“ Und damit zog er sein kleines Schwert und schwang es in den Lüften und rief: „Ihr meine lieben Vasallen, Freunde und Brüder, wollt ihr mir beistehen im harten Kampf ?“ – Sogleich schrien heftig drei Skaramuzze, ein Pantalon, vier Schornsteinfeger, zwei Zitherspielmänner und ein Tambour: „Ja Herr – wir hängen Euch an in standhafter Treue – mit Euch ziehen wir in Tod, Sieg und Kampf!“ und stürzten sich nach dem begeisterten Nußknacker, der den gefährlichen Sprung wagte, vom obern Fach herab. Ja! jene hatten gut sich herabstürzen, denn nicht allein daß sie reiche Kleider von Tuch und Seide trugen, so war inwendig im Leibe auch nicht viel anders als Baumwolle und Häcksel, daher plumpten sie auch herab wie Wollsäckchen. Aber der arme Nußknacker, der hätte gewiß Arm und Beine gebrochen, denn, denkt euch, es war beinahe zwei Fuß hoch vom Fache, wo er stand, bis zum untersten, und sein Körper war so spröde als sei er geradezu aus Lindenholz geschnitzt. Ja Nußknacker hätte gewiß Arm und Beine gebrochen, wäre, im Augenblick als er sprang, nicht auch Mamsell Clärchen schnell vom Sofa aufgesprungen und hätte den Helden mit dem gezogenen Schwert in ihren weichen Armen aufgefangen. „Ach du liebes gutes Clärchen!“ schluchzte Marie, „wie habe ich dich verkannt, gewiß gabst du Freund Nußknackern dein Bettchen recht gerne her!“ Doch Mamsell Clärchen sprach jetzt, indem sie den jungen Helden sanft an ihre seidene Brust drückte: „Wollet Euch, o Herr! krank und wund wie Ihr seid, doch nicht in Kampf und Gefahr begeben, seht wie Eure tapferen Vasallen kampflustig und des Sieges gewiß sich sammeln. Skaramuz, Pantalon, Schornsteinfeger, Zitherspielmann und Tambour sind schon unten und die Devisen-Figuren in meinem Fache rühren und regen sich merklich! Wollet, o Herr! in meinen Armen ausruhen, oder von meinem Federhut herab Euern Sieg anschaun!“ So sprach Clärchen, doch Nußknacker tat ganz ungebärdig und strampelte so sehr mit den Beinen, daß Clärchen ihn schnell herab auf den Boden setzen mußte. In dem Augenblick ließ er sich aber sehr artig auf ein Knie nieder und lispelte: „O Dame! stets werd ich Eurer mir bewiesenen Gnade und Huld gedenken in Kampf und Streit!“ Da bückte sich Clärchen so tief herab, daß sie ihn beim Ärmchen ergreifen konnte, hob ihn sanft auf, löste schnell ihren mit vielen Flittern gezierten Leibgürtel los und wollte ihn dem Kleinen umhängen, doch der wich zwei Schritte zurück, legte die Hand auf die Brust, und sprach sehr feierlich: „Nicht so wollet o Dame, Eure Gunst an mir verschwenden, denn –“ er stockte, seufzte tief auf, riß dann schnell das Bändchen, womit ihn Marie verbunden hatte, von den Schultern, drückte es an die Lippen, hing es wie eine Feldbinde um, und sprang, das blankgezogene Schwertlein mutig schwenkend, schnell und behende wie ein Vögelchen über die Leiste des Schranks auf den Fußboden. – Ihr merkt wohl höchst geneigte und sehr vortreffliche Zuhörer, daß Nußknacker schon früher als er wirklich lebendig worden, alles Liebe und Gute, was ihm Marie erzeigte, recht deutlich fühlte, und daß er nur deshalb, weil er Marien so gar gut worden, auch nicht einmal ein Band von Mamsell Clärchen annehmen und tragen wollte, unerachtet es sehr glänzte und sehr hübsch aussah. Der treue gute Nußknacker putzte sich lieber mit Mariens schlichtem Bändchen. – Aber wie wird es nun weiter werden? – Sowie Nußknacker herabspringt, geht auch das Quieken und Piepen wieder los. Ach! unter dem großen Tische halten ja die fatalen Rotten unzähliger Mäuse und über alle ragt die abscheuliche Maus mit den sieben Köpfen hervor! – Wie wird das nun werden! – |
Der Weihnachtsabend in der Familie Thalberg. Kolorierter Kupferstich.
Die beiden jüngsten
Kinder der
Familie Stahlbaum stehen im Zentrum der weihnachtlichen Geschichte. Marie
rückt dabei als Protagonistin deutlicher im Fokus als Fritz, da das gesamte
Geschehen vornehmlich aus ihrer Perspektive geschildert wird. Betrachtet man
das Figurentableau, stehen beide Kinder abseits der restlichen Familie und
dem Paten Droßelmeier. In ihrer kindlichen Naivität, wie es aus der Sicht
des Lesers aber auch der Eltern erscheint, liegt die Fähigkeit verborgen,
die Wunderdinge in der aufgeklärten Alltagswelt
erkennen zu können. Die Kinder sind somit die einzigen aus dieser
aufgeklärten, bürgerlichen Familie, die sich nicht vor dem Wunderbaren
verschließen.
Maries Wahrnehmung der Innen- und
Außenwelt Puppen zur Wohnung: Puppenstuben und Puppenhäuser erfreuten sich im 19. jahrhundert großer Beliebtheit. Es handelt sich um Nachbildung einer Wohnung oder eines Hauses im Kleinformat, für Miniaturpuppen möbliert und eingerichtet. Puppenstuben und ihr Mobiliar werden traditionell aus Holz hergestellt. Das erste „moderne“ Puppenhaus, das mit erzieherischer Intention gefertigt wurde, schuf 1631 Anna Köferlin in Nürnberg, die dazu auch ein Flugblatt herstellen ließ. Mädchen sollten spielerisch auf ihre spätere Aufgabe als Hausfrau und Mutter vorbereitet werden. Erst im Biedermeier fand das Spielzeug aber weitere Verbreitung. Vorbild waren die Wohnungen gehobener Bürgerfamilien, die möglichst originalgetreu nachgebildet wurden.
Kantonierungsquartiere: Truppenunterkunft Lichter: Seit 1725 gab es mit dem Walrat einen von sich aus weißen Kerzengrundstoff, der vornehmlich für Luxuskerzen benutzt wurde. Freund Nußknacker:
Maries Blick auf den Nussknacker
erscheint dieser zunehmend lebendiger und menschlicher zu werden, bis es
schließlich zur vollständigen Verlebendigung der Holzpuppe und der anderen
Spielzeuge, bis hin zur Verwandlung in einen Menschen kommt. Unter dem
imaginativen Blick gerät hier ein unbelebtes Objekt zur Projektionsfläche
und erweckt schließlich den Eindruck der Lebendigkeit. Diese Konstellation
lässt sich mit Ovid seit der Antike paradigmatisch im Pygmalion-Mythos
finden. Die geschlechtsspezifische Blickkonfiguration – der männliche,
produktive Schöpfer blickt auf das von ihm erschaffene, weibliche Objekt –
zieht sich seitdem durch die Literatur- und Kunstgeschichte. Zu finden ist
das Pygmalion-Motiv auch in Hoffmanns Sandmann, in dem Nathanaels
narzisstisch besetzte Liebe zur eigentlich leblosen Automate Olimpia sich
ebenfalls über seinen projektiv-verzerrten Blick definiert. Im Nussknacker
wird die Geschlechterverteilung nun umgekehrt: Es ist die kleine Marie, die
auf den männlichen Nussknacker schaut, diesen mit Projektionen belegt und
unter ihrem Blick zum Leben erweckt. Marie wird so zur produktiven und
kreativen Schöpferin, womit eine Verschiebung der tradierten
Pygmalion-Konfiguration in Szene gesetzt ist. Im Zusammenhang mit der
darauffolgenden Schlacht zwischen dem Nussknacker und der Mäusearmee
eröffnet sich eine imaginative Sphäre, die von Maries Imaginationskraft
konstituiert ist, über die die Spielzeuge zum Leben erweckt werden.
Inwiefern Maries phantastische Erlebnisse tatsächlich geschehen und Teil
einer wunderbaren Welt oder doch kindliche oder gar pathologische
Einbildungen sind, lässt der Text bis zum Schluss offen. Der
Imaginationskraft ist in E. T. A. Hoffmanns Werk besondere Bedeutsamkeit
zuzuschreiben. Sie fungiert als Kraft im Inneren des Künstlers, dem mit
Hoffmanns ›serapiontischem Prinzip‹ ein autonomes kreatives Vermögen
zugeschrieben wird; viele der Hoffmann’schen Figuren verfügen über eine
ausgeprägte Imaginationskraft, die die Duplizität von gewöhnlicher und
phantastischer Ebene eröffnet. Das serapiontische Prinzip findet sich als
produktionsästhetische Regel in der ersten Erzählung der Serapions-Brüder
formuliert: Als Namengeber fungiert der Einsiedler Serapion, der als »wahrhafte[r]
Dichter« (zit. nach: Hoffmann, Sämtliche Werke, Bd. 4, S. 68) im Sinne der
Romantik physisch wie auch geistig abseits von Welt und Gesellschaft lebt.
Zentral für das serapiontische Prinzip ist die ›innere Schau‹, die innere
Bilder im Äußeren zu Kunst transformiert und sich von den Serapionsbrüdern
folgendermaßen formuliert findet: »Jeder prüfe wohl, ob er auch wirklich das
geschaut, was er zu verkünden unternommen, ehe er es wagt laut damit zu
werden. Wenigstens strebe jeder recht ernstlich darnach, das Bild, das ihm
im Innern aufgegangen recht zu erfassen mit allen seinen Gestalten, Farben,
Lichtern und Schatten, und dann, wenn er sich recht entzündet davon fühlt,
die Darstellung ins äußere Leben zu tragen« (ebd., S. 69). Die hier
beschriebene Poetik der inneren Schau ist anti-mimetisch und beruht auf der
ausgeprägten kreativen Imaginationskraft des Künstlers, welcher sich der
Duplizität der Alltagswelt und der phantastisch-poetischen Realitätsebene
bewusst ist. Die Imaginationskraft ermöglicht es ihm, die vollkommene
Gestaltung des Kunstwerks in seinem Inneren zu erblicken. Das im Inneren
bereits vorhandene, genialische Kunstwerk muss zur ästhetischen Produktion
in die Außenwelt übertragen werden, indem es auf eine äußere ›Leinwand‹
projiziert wird. Das serapiontische Prinzip lässt sich damit als
Projektionsvorgang verstehen, der die ästhetische Produktion mit
optisch-medialen Blickkonstellationen verknüpft. In gleicher Weise findet
auch die Verlebendigung des Nussknackers durch Marie statt. Die Opposition
zwischen der genialischen Innenwelt und der gewöhnlichen Außenwelt wird
durch die Imaginationskraft überbrückt; sie ist eine zentrale Komponente des
serapiontischen Prinzips. Seit der Antike bewegt sie sich in einem
Spannungsverhältnis zwischen ihrer schöpferischen und destruktiven Form:
Wird die Imagination nicht vom männlich codierten Verstand reguliert, droht
sie pathologisch und unkontrollierbar zu werden. Die Ambivalenz der
Imagination weist damit eine geschlechtsspezifische Konzeption auf, die sich
teilweise auf die voraufklärerische medizinische Imaginationslehre
zurückführen lässt. Diese schreibt Frauen eine destruktive mütterliche
Imaginationskraft zu, mittels derer sie für pränatale Missbildungen von
Babys verantwortlich gemacht wurden. Während die männlich codierte
produktive und durch die Vernunft regulierte Imaginationskraft kreative,
geniale Kunst hervorbringt, wird der weiblichen Imaginationskraft eine
pathologische Wirkung zugeschrieben. Die dem serapiontischen Prinzip
zugrundeliegende Imaginationskraft ist in Anknüpfung an den traditionellen
Imaginationsdiskurs ebenfalls von Ambivalenz geprägt: In der künstlerischen
Produktion ist sie eine autonome Kraft von enormem schöpferischen Potenzial.
Gelingt dem Künstler aber die Transformation des im Inneren ›geschauten‹
Kunstwerkes in die Außenwelt nicht mehr, bleibt er in seiner
Imaginationskraft gefangen und lebt, wie der Einsiedler Serapion, nur noch
in deren inneren Bildern. Die beiden Pole der Imaginationskraft – geniale
Kunstschöpfung und Wahnsinn – werden im serapiontischen Prinzip enggeführt.
E. T. A. Hoffmanns Nathanael im Sandmann, Anselmus im Goldnen Topf und der
Namengeber Serapion selbst sind die wohl prominentesten Beispiele für
Figuren, die zwischen Genie und Wahnsinn angesiedelt sind. Sind die
genannten Protagonisten männlich, haben wir es bei Marie in Nussknacker und
Mausekönig mit einem jungen Mädchen zu tun, das durch seine
Imaginationskraft Spielzeuge zum Leben erweckt – allen voran den Nussknacker
– und darüber seine eigene phantastische Welt generiert. Indem Marie die
Position der produktiv wirkenden Schöpferin einnimmt, werden die tradierten
Geschlechtszuschreibungen des Imaginations- und Kunstdiskurses in Hoffmanns
Märchen umgekehrt. Lampe: Der größte Schritt auf dem Weg zu einer heller brennenden Öllampe gelang Aimé Argand, einem in Frankreich lebenden Schweizer, der etwa um 1783 eine Lampe vorstellte, deren Brenner aus einem Metallzylinder mit doppelter Wand konstruiert war. In der hohlen Wand war ein runder Baumwolldocht befestigt mit einer Brennstoffzuführung durch einen separaten Tank. Der innere Zylinder war unten offen, sodass Luft hindurch innen an den Docht gelangen konnte. Zudem setzte Argand einen Blechzylinder über die Flamme, um durch Kaminwirkung einen höheren Zug zu erhalten. Der Blechzylinder wurde im Jahr 1784 durch einen Glaszylinder ersetzt.
Eine Argand-Lampe im Einsatz ; Abbildung in: A Portrait of James Peale, 1822 von Charles Willson Peale
„Muck“!:
interjection eines kurz aufbrummenden: muck, vom laute eines der den
mund kaum aufmacht zum reden; jetzt häufig in gewöhnlicher rede er wagt
nicht muck zu sagen, keinen noch so leisen widerspruch zu erheben; die
frau führt das regiment, der mann darf nicht muck sagen.
Glockenspiel: Die Spieldose ist ein selbstspielendes mechanisches
Musikinstrument. Daneben gibt es die Spieluhr mit mechanischem Uhrwerk und
Uhrfeder, die eine Melodie spielt. Die Erfindung der Musikdose geht auf den
Genfer Uhrmacher Antoine Favre-Salomon zurück, der 1796 das Prinzip der
klingenden Stahlzunge für eine musizierende Taschenuhr anwendete (hier
deutet sich der Ursprung für den Begriff „Spiel-Uhr“ an).
Schnack:
schnack, geschwätz, geplapper, dummes gerede, dummes zeug Vasallen: Vasall heißt ein abhängiger Gefolgsmann, der von einem Lehnsherrn ein Lehen (Land und Amt) zugeordnet bekam und dafür Treue und Leistungen, wie militärische Gefolgschaft, zu erbringen hatte. Karamuzze: Scaramouche, Scaramuz oder Skaramuz ist eine komische Figur des italienischen Volkstheaters Commedia dell’arte. Das Wort stammt vom italienischen Wort Scaramuccia, auch Scaramuzzo, und bedeutet „Scharmützel“, auch im Sinne eines Wortgefechts. Im Französischen heißt die Figur Scaramouche, im Englischen kennt man umgangssprachlich den scaramouch im Sinne von „Großmaul“. Skaramuz tritt meist in spanischer Tracht und ganz schwarz gekleidet auf. Er vertritt den Typus des neapolitanischen Abenteurers und Aufschneiders. Meist wird er am Ende von Arlecchino durchgeprügelt.
Pantalon:
Der Pantalone ist eine der am wenigsten
veränderten Masken der italienischen Commedia dell’arte. Er ist ein alter,
geschäftstüchtiger, gleichzeitig geiziger, meist verliebter und stets
betrogener Modenarr, der in gelben Pantoffeln, rotem Wams und enger roter
Strumpfhose sowie einem schwarzen Umhang auftritt, meist seinen Geldbeutel
gut sichtbar in Höhe der Geschlechtsteile befestigt und einen spitzen Bart
tragend. Auf Stichen von Jacques Callot und Gemälden von Antoine Watteau
wird er häufig den Oberkörper vorgebeugt dargestellt. Er gehört mit dem
Dottore zur Gruppe der Vecchi (Italienisch: die Alten), denen die Zanni, die
Diener, gegenüberstehen. Als Ehemann bekommt er Hörner aufgesetzt; als
Witwer auf Freiersfüßen steigt er erfolglos jungen Mädchen hinterher; als
Vater versucht er sich in die Liebesdinge seiner Tochter einzumischen, ihre
Liebschaft zu verhindern und sie zu seinem eigenen Vorteil zu verkuppeln.
Dabei gibt er ein willkommenes Opfer für seine Dienerschaft ab und fällt auf
jede Intrige herein; zum Schluss des Stücks stellt er sich aber gerne als
der heimliche Arrangeur dar.
Figuren der Commedia dell'arte. Kleine bemalte Gipsstatuen (ca. 100 cm) aus dem Théâtre Séraphin, die Ende des 18. Jahrhunderts im Palais-Royal aufgestellt wurden und im Musée Carnavalet in Paris aufbewahrt werden (Harlekin – Pantalone – Il Dottore). Tambour: Trommler (besonders beim Militär)
|
Häcksel: klein gehacktes Stroh, das neben Baumwolle zum Füllen von Stoffpuppen benutzt wurde.
Clärchen: Spiel, Spielzeuge und Weihnachtsgaben
Im Nußknacker erscheint das Spiel auf motivischer Ebene, am auffallendsten
in den Spielzeugen und in den Spielen der Kinder. In Form von Spielzeugen
wird das Motiv in den Weihnachtsgaben eingeführt. Zugleich wird das
Verhältnis der Kinder zueinander und zum Spielen thematisiert. Während Fritz
von typischen Bubenspielsachen träumt (neue Husaren, ein Fuchs usw.) zieht
Marie Mädchensachen, wie Puppen und schöne Kleider vor. [...]
Bei Maries Spielen ist eindeutig das Überwiegen des Moments der mimicry, der Verkleidung und Nachahmung festzustellen. Dies bezieht sich aber vor allem auf ihr Verhalten in der bürgerlichen Welt. Im wunderbaren Bereich wird sie nicht nur Zeuge der Schlacht zwischen Nußknacker und den Mäusen, sondern nimmt auch selber daran teil, entscheidet sogar ihren Ausgang durch ihr Eingreifen, als sie mit ihrem hingeworfenen Pantoffel das Mauseheer verjagt. So hat sie also auch am agôn teil . Betrachtet man genauer, wie Marie spielt, kann man, als eine Deutungsmöglichkeit mit verfolgen, wie allmählich die Wirklichkeit um sie herum verschwindet, d.h. wie sie sich bis zum Rausch ins Spiel hineinsteigert. Bereits als Fritz und Marie besprechen, was ihnen das Christkind diesmal wohl bescheren werde, spricht Marie über ihre Puppe, Mamsel Trutchen als wenn sie lebte: Marie meinte, daß Mamsel Trutchen (ihre große Puppe) sich sehr verändere, denn ungeschickter als jemals fiele sie jeden Augenblick auf den Fußboden, welches ohne garstige Zeichen im Gesicht nicht abginge, und dann sei an Reinlichkeit der Kleidung gar nicht mehr zu denken. Alles tüchtige Ausschelten helfe nichts. [...]
Den Übergang zum Versinken im Spiel bildet die Stelle, wo Nußknacker und
Fritzs Husaren im Begriff sind aus dem Schrank zu springen und gegen das
Mäuseheer zu ziehen. Er springt aus dem zweiten Fach herunter und Mamsel
Clärchen – eine andere Puppe von Marie – will ihn dazu überreden, wegen
seiner Verletzung nicht in den Kampf zu ziehen. Mamsel Clärchens Worte
werden zitiert, es ist aber wahrscheinlich Marie, die spielt, dass ihre
Puppe sich so benimmt. Etwas später aber, als Mamsel Clärchen ein Band von
ihrem Kleid Nußknacker geben will, lehnt Nußknacker diese Gunst ab und
drückt das Band, womit Marie seine Schulter aufband an seine Lippen.
An diesem Punkt identifiziert sich Marie nicht mehr mit ihrer Puppe, sondern
übernimmt
deren Rolle im Spiel der Nachahmung (mimicry) romantischer Liebeswerbung. Es
ist wichtig zu bemerken, dass dies bereits nach ihrer Verwundung geschieht
und somit der rationalen Sphäre zweifach motiviert entrückt wird.
Tünde Pasky 2010, S. 435-437.

Puppe mit bemaltem Holzkopf, um 1810
Devisen-Figuren: Backwerk, in das kleine Zettel mit Wahlsprüchen enthalten sind.

|
Die Schlacht „Schlagt den Generalmarsch, getreuer Vasalle Tambour!“ schrie Nußknacker sehr laut und sogleich fing der Tambour an, auf die künstlichste Weise zu wirbeln, daß die Fenster des Glasschranks zitterten und dröhnten Nun krackte und klapperte es drinnen und Marie wurde gewahr, daß die Deckel sämtlicher Schachteln worin Fritzens Armee einquartiert war mit Gewalt auf- und die Soldaten heraus und herab ins unterste Fach sprangen, dort sich aber in blanken Rotten sammelten. Nußknacker lief auf und nieder, begeisterte Worte zu den Truppen sprechend: „Kein Hund von Trompeter regt und rührt sich“, schrie Nußknacker erbost, wandte sich aber dann schnell zum Pantalon, der etwas blaß geworden, mit dem langen Kinn sehr wackelte, und sprach feierlich: „General, ich kenne Ihren Mut und Ihre Erfahrung, hier gilt's schnellen Überblick und Benutzung des Moments – ich vertraue Ihnen das Kommando sämtlicher Kavallerie und Artillerie an – ein Pferd brauchen Sie nicht, Sie haben sehr lange Beine und galoppieren damit leidlich. – Tun Sie jetzt was Ihres Berufs ist.“ Sogleich drückte Pantalon die dürren langen Fingerchen an den Mund und krähte so durchdringend, daß es klang als würden hundert helle Trompetlein lustig geblasen. Da ging es im Schrank an ein Wiehern und Stampfen, und siehe, Fritzens Kürassiere und Dragoner, vor allen Dingen aber die neuen glänzenden Husaren rückten aus, und hielten bald unten auf dem Fußboden. Nun defilierte Regiment auf Regiment mit fliegenden Fahnen und klingendem Spiel bei Nußknacker vorüber und stellte sich in breiter Reihe quer über den Boden des Zimmers. Aber vor ihnen her fuhren rasselnd Fritzens Kanonen auf, von den Kanoniern umgeben, und bald ging es bum – bum und Marie sah wie die Zuckererbsen einschlugen in den dicken Haufen der Mäuse, die davon ganz weiß überpudert wurden und sich sehr schämten. Vorzüglich tat ihnen aber eine schwere Batterie viel Schaden, die auf Mamas Fußbank aufgefahren war und Pum – Pum – Pum, immer hintereinander fort Pfeffernüsse unter die Mäuse schoß, wovon sie umfielen. Die Mäuse kamen aber doch immer näher und überrannten sogar einige Kanonen, aber da ging es Prr – Prr, Prr, und vor Rauch und Staub konnte Marie kaum sehen, was nun geschah. Doch so viel war gewiß, daß jedes Korps sich mit der höchsten Erbitterung schlug, und der Sieg lange hin und her schwankte. Die Mäuse entwickelten immer mehr und mehr Massen, und ihre kleinen silbernen Pillen, die sie sehr geschickt zu schleudern wußten, schlugen schon bis in den Glasschrank hinein. Verzweiflungsvoll liefen Clärchen und Trutchen umher, und rangen sich die Händchen wund. „Soll ich in meiner blühendsten Jugend sterben! – ich die schönste der Puppen!“ schrie Clärchen. „Hab ich darum mich so gut konserviert, um hier in meinen vier Wänden umzukommen?“ rief Trutchen. Dann fielen sie sich um den Hals, und heulten so sehr, daß man es trotz des tollen Lärms doch hören konnte. Denn von dem Spektakel, der nun losging, habt ihr kaum einen Begriff, werte Zuhörer. – Das ging – Prr – Prr – Puff, Piff – Schnetterdeng – Schnetterdeng – Bum, Burum, Bum – Burum – Bum – durcheinander und dabei quiekten und schrien Mauskönig und Mäuse, und dann hörte man wieder Nußknackers gewaltige Stimme, wie er nützliche Befehle austeilte und sah ihn, wie er über die im Feuer stehenden Bataillone hinwegschritt! – Pantalon hatte einige sehr glänzende Kavallerieangriffe gemacht und sich mit Ruhm bedeckt, aber Fritzens Husaren wurden von der Mäuseartillerie mit häßlichen, übelriechenden Kugeln beworfen, die ganz fatale Flecke in ihren roten Wämsern machten, weshalb sie nicht recht vor wollten: Pantalon ließ sie links abschwenken und in der Begeisterung des Kommandierens machte er es ebenso und seine Kürassiere und Dragoner auch, das heißt, sie schwenkten alle links ab, und gingen nach Hause. Dadurch geriet die auf der Fußbank postierte Batterie in Gefahr, und es dauerte auch gar nicht lange, so kam ein dicker Haufe sehr häßlicher Mäuse und rannte so stark an, daß die ganze Fußbank mitsamt den Kanonieren und Kanonen umfiel. Nußknacker schien sehr bestürzt; und befahl, daß der rechte Flügel eine rückgängige Bewegung machen solle. Du weißt, o mein kriegserfahrner Zuhörer Fritz! daß eine solche Bewegung machen, beinahe so viel heißt als davonlaufen und betrauerst mit mir schon jetzt das Unglück, was über die Armee des kleinen von Marie geliebten Nußknackers kommen sollte! – Wende jedoch dein Auge von diesem Unheil ab, und beschaue den linken Flügel der Nußknackerischen Armee, wo alles noch sehr gut steht und für Feldherrn und Armee viel zu hoffen ist. Während des hitzigsten Gefechts waren leise leise Mäuse-Kavalleriemassen unter der Kommode herausdebouchiert, und hatten sich unter lautem gräßlichen Gequiek mit Wut auf den linken Flügel der Nußknackerischen Armee geworfen, aber welchen Widerstand fanden sie da! – Langsam, wie es die Schwierigkeit des Terrains nur erlaubte, da die Leiste des Schranks zu passieren, war das Devisen-Korps unter der Anführung zweier chinesischer Kaiser vorgerückt, und hatte sich en quarré plain formiert. – Diese wackern, sehr bunten und herrlichen Truppen, die aus vielen Gärtnern, Tirolern, Tungusen, Friseurs, Harlekins, Kupidos, Löwen, Tigern, Meerkatzen und Affen bestanden, fochten mit Fassung, Mut und Ausdauer. Mit spartanischer Tapferkeit hätte dies Bataillon von Eliten dem Feinde den Sieg entrissen, wenn nicht ein verwegener feindlicher Rittmeister tollkühn vordrängend einem der chinesischen Kaiser den Kopf abgebissen und dieser im Fallen zwei Tungusen und eine Meerkatze erschlagen hätte. Dadurch entstand eine Lücke, durch die der Feind eindrang und bald war das ganze Bataillon zerrissen. Doch wenig Vorteil hatte der Feind von dieser Untat. Sowie ein Mäusekavallerist mordlustig einen der tapfern Gegner mittendurch zerbiß, bekam er einen kleinen gedruckten Zettel in den Hals, wovon er augenblicklich starb. – Half dies aber wohl auch der Nußknackerischen Armee, die, einmal rückgängig geworden, immer rückgängiger wurde und immer mehr Leute verlor, so daß der unglückliche Nußknacker nur mit einem gar kleinen Häufchen dicht vor dem Glasschranke hielt? „Die Reserve soll heran! – Pantalon – Skaramuz, Tambour – wo seid ihr?“ – So schrie Nußknacker, der noch auf neue Truppen hoffte, die sich aus dem Glasschrank entwickeln sollten. Es kamen auch wirklich einige braune Männer und Frauen aus Thorn mit goldnen Gesichtern, Hüten und Helmen heran, die fochten aber so ungeschickt um sich herum, daß sie keinen der Feinde trafen und bald ihrem Feldherrn Nußknacker selbst die Mütze vom Kopfe heruntergefochten hätten. Die feindlichen Chasseurs bissen ihnen auch bald die Beine ab, so daß sie umstülpten und noch dazu einige von Nußknackers Waffenbrüdern erschlugen. Nun war Nußknacker vom Feinde dicht umringt, in der höchsten Angst und Not. Er wollte über die Leiste des Schranks springen, aber die Beine waren zu kurz, Clärchen und Trutchen lagen in Ohnmacht, sie konnten ihm nicht helfen – Husaren – Dragoner sprangen lustig bei ihm vorbei und hinein, da schrie er auf in heller Verzweiflung: „Ein Pferd – ein Pferd – ein Königreich für ein Pferd!“ – In dem Augenblick packten ihn zwei feindliche Tirailleurs bei dem hölzernen Mantel und im Triumph aus sieben Kehlen aufquiekend, sprengte Mausekönig heran. Marie wußte sich nicht mehr zu fassen, „o mein armer Nußknacker – mein armer Nußknacker!“ so rief sie schluchzend, faßte, ohne sich deutlich ihres Tuns bewußt zu sein, nach ihrem linken Schuh, und warf ihn mit Gewalt in den dicksten Haufen der Mäuse hinein auf ihren König. In dem Augenblick schien alles verstoben und verflogen, aber Marie empfand am linken Arm einen noch stechendern Schmerz als vorher und sank ohnmächtig zur Erde nieder.
|
E. T. A. Hoffmann war Zeitgenosse der
napoleonischen Ära. Im November 1806 hatte er, wie alle preußischen Beamten,
die keinen Eid auf die von Napoleon eingesetzte Regierung leisteten, seine
Stellung als Regierungsrat in Warschau verloren. Er hat später die Schlacht
bei Dresden, Napoleons letzten Sieg, unmittelbar miterlebt und mehrfach über
die Kriegsereignisse [...] geschrieben; und zwar nicht nur in Briefen und
Tagebuchaufzeichnungen, sondern auch in literarischen Werken
unterschiedlichen Charakters, so vor allem in Die Vision auf dem
Schlachtgelde bei Dresden, in der Schrift Drei verhängnisvolle Monate
und in den Erzählungen Der Dey von Elba in Paris, Der Dichter und
der Komponist und Erscheinungen.
Die Schlacht um Dresden fand am 26. und 27.
August 1813 zwischen französischen Truppen unter Napoleon und der Hauptarmee
der verbündeten Koalitionäre Österreich, Preußen und Russland unter Karl
Philipp Fürst zu Schwarzenberg statt. Napoleon errang hier einen seiner
letzten Siege auf deutschem Boden.
Die Schlacht um Dresden, Lithographie von Antoine Vernet und Jacques Sweba
Kürassiere:
Kürassiere (anfangs auch Kürisser genannt, über Cuirassier von französisch
cuirasse für „Lederpanzer“, von cuir „Leder“) sind eine mit Kürassen
genannten Brustpanzern ausgestattete Truppengattung der schweren Kavallerie.
Neben den Lanzierern entstanden sie in der Frühen Neuzeit und bildeten mit
diesen als „Schwere Reiter“ das Gegenstück zu den Chevaulegers. Der Begriff
Kürass kam im 15. Jahrhundert im deutschen Sprachraum auf und bezeichnete
die lederne Panzerung des Oberkörpers. Daraus abgeleitet entstand um 1500
die Bezeichnung Kürisser. Obgleich die Panzerung bald meist aus Metall war
und die Panzerung der Arme und zuweilen auch des Rückens entfiel, hielt sich
der Begriff. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts bestand die schwere Reiterei nur
mehr aus Kürassieren, während die Bezeichnung selbst erst in den
Koalitionskriegen allgemein üblich wurde. Kanoniern: Kanonier (kurz: Kan) ist die Bezeichnung für Angehörige einer Geschützbedienung, aber auch unterster Dienstgrad für Soldaten der Artillerie.
Zuckererbsen:
zuckererbsen, gattung von confect
eine schwere Batterie:
Eine Batterie (Bttr.) ist einerseits eine Stellung mehrerer Geschütze. Da in
den Anfangszeiten der Artillerie die Feuerrate und die Treffergenauigkeit
der Geschütze gering waren, wurden die Geschütze zu Gruppen zusammengefasst.
Diese Gruppen nannte man Batterie, sinngemäß: „Was zum Schlagen erforderlich
ist“ (aus lateinisch battuere, französisch battre ‚schlagen‘; bataille
‚Schlacht‘, daraus Bataillon). Pfeffernüsse: Die Pfeffernuss ist eine Gebäckspezialität. Die deutsche Küche kennt verschiedene Arten von Pfeffernüssen. In dem Gebäck ist meist kein Pfeffer enthalten, der Teig jedoch in der Regel würzig. Wie bei den Lebkuchen, die auch Pfefferkuchen genannt werden, geht die Bezeichnung wohl auf das Mittelalter zurück, als exotische Gewürze ganz allgemein als Pfeffer bezeichnet wurden. Die Außenseite der Pfeffernüsse ist in der Regel mit einem weißen Zuckerguss versehen.
Korps: Ein Korps (französisch corps ‚Körper(schaft)‘, von lateinisch corpus ‚Körper‘) ist ein in militärischen und in zivilen Bereichen verwendeter Begriff für Organisationseinheiten. Innerhalb der militärischen Terminologie wird der Begriff verwendet für ein operativer Heereskörper aus militärischen Verbänden bestehend, wie das Armee-Korps oder das Expeditionskorps.
Pillen:
arzneikügelchen, zum verschlucken so gut konserviert: durch sorgfältige Pflege gut erhalten
Fußbank: bank,
brustwehr; über bank schieszen, wenn keine schieszscharten in der brustwehr
sind; eine batterie deren bedienungsmannschaft zu fusze geht. kriegserfahrener Zuhörer: Hoffmann parodiert mit seiner Spielzeug-Schlacht die Ereignisse der Schlacht um Dresden, die am 26. August 1813 begann und drei Tage dauerte. Die Alliierten, unter der Führung des österreichischen Feldmarschalls Schwarzenberg, umzingelten die Stadt Dresden, in der sich Napoleon mit seiner Grande Armée befand. Napoleon gelang es jedoch, die feindlichen Truppen zurückzuschlagen und den Großteil der alliierten Armee zu besiegen. Nach drei Tagen intensiver Kämpfe gewann Napoleon die Schlacht bei Dresden.
Das Bild, das sich Hoffmann vom größten
Nachbarland Deutschlands hat machen können, bleibt durch die
nachrevolutionären Ereignisse wesentlich geprägt: in der Zeit seiner
Einstellung (ab 1813) als Musikdirektor bei der Secondaschen Truppe (mal in
Leipzig, mal in Dresden auftretend) wird er zum entsetzten Zeugen der
Befreiungskriege, wie seine Vision auf dem Schlachtfelde bei Dresden
(einer der wenigen Texte in Hoffmanns Produktion, die einen
geschichtsbezogenen und stark autobiografischen Charakter aufweisen) es
bekundet. Dreimal bietet sich ihm die Gelegenheit, den „Kaiser der
Franzosen” in Person zu sehen und bei der einen, auf der Elbbrücke in
Dresden, genügt sein „furchtbare[r] Tyrannenblick”, um Hoffmanns „durchaus
leidenschaftlich anti-französisch[es] und anti-napoleonisch[es]”
Ressentiment zu schüren. In diesem Zusammenhang wären auch zwei andere Texte
zu nennen, in denen sich Hoffmann mit dem ‚Phänomen Napoleon’ weiter
auseinandersetzt: das Prosastück Der Dey von Elba in Paris (1815
veröffentlicht) und der als eine „Art Tagebuch” im September 1813 verfasste
autobiografische Aufsatz Drei verhängnisvolle Monate! (Auszug aus meinem
Tagebuch für die Freunde)
|
Die Vision auf dem Schlachtfelde bei Dresden.
Auf den dampfenden Ruinen des Feldschlößchens stand ich und sah hinab in die mit blutigen Leichen, mit Sterbenden bedeckte Ebene. Das dumpfe Röcheln des Todeskampfes, das Gewinsel des Schmerzes, das entsetzliche Geheul wütender Verzweiflung durchschnitt die Lüfte, und wie ein ferner Orkan brauste der Kanonendonner, die noch nicht gesättigte Rache furchtbar verkündend. Da war es mir, als zöge ein dünner Nebel über die Flur, und in ihm schwamm eine Rauchsäule, die sich allmählich verdickte zu einer finstern Gestalt. Näher und näher schwebend stand sie hoch über meinem Haupte, da regte und bewegte sich alles auf dem Schlachtfelde; zerrissene Menschen standen auf und streckten ihre blutigen Schädel empor, und wilder wurde das Geheul, entsetzlicher der Jammer! Ein wunderbarer roter Schein blitzte, wie aus der Tiefe der Erde fahrend, durch die Luft, und aus Osten und Westen kamen lange – lange Züge leuchtender Gerippe heran, in den knöchernen Fäusten Schwerter tragend, und sie erhebend gegen die Gestalt – und immer wilder wurde das Geheul – entsetzlicher der Jammer! Aufs neue blitzte der rote Schein aus tiefer Erde, und aus Mittag und Mitternacht zogen zahllos die Gerippe heran mit glühenden Schwertern der Gestalt drohend. Und immer wilder und wilder wurde das Geheul, entsetzlicher der Jammer:
»Rache – Rache – unsere Qual über dich, blutiger Mörder!« Aus den blutigen Augen der Leichname, aus den knöchernen Augenhöhlen der Gerippe schoßen Strahlen hinauf, die wie in emporflackernden Flammen die Gestalt erleuchteten. – Es war der Tyrann! – Er streckte seine Rechte aus über die Ebene und sprach:
»Was wollt ihr, Thörichte, bin ich nicht selbst die Rache, bin ich nicht selbst das Verhängnis, dem ihr dienend gehorchen müßt?«
Da schrieen die Stimmen von der Ebene herauf:
»Verworfener! höhne nicht die Macht, die hoch über dir schwebt – schaue über dich, Verblendeter!«
Aber der Tyrann senkte sein Haupt noch tiefer herab und sprach:
»Erkennt ihr mich? – ich bin der Tod!«
Da heulten noch wütender die Stimmen:
»Verworfener! höhne nicht die Macht, die den Tod sendet. Schaue über dich!«
Doch nicht aufwärts richtete der Tyrann seinen Blick, sondern zur Erde starrend sprach er:
»Wahnsinnige! was sucht ihr über meinem Haupt? – über mir [ist] nichts! – öde ist der finstere Raum da droben, denn ich selbst bin die Macht der Rache und des Todes, und wenn ich meine Arme ausstrecke über euch, verstummt euer Jammer, und ihr sinkt vernichtet in den Staub!«
Und als er dies gesprochen, streckte er seine Arme, wie im roten Feuer glühende Sicheln weit über die Ebene, und es war, als öffne die Erde den schwarzen bodenlosen Abgrund, die Leichname und Gerippe versanken und ihr Geheul, ihr schneidender Jammer verhallte in der Tiefe. Da fuhr es herauf im tosenden Ungestüm wie eine Windsbraut, die Erde bebte, und in dem Sturme heulte und winselte die tiefe Klage von tausend Menschenstimmen. Nun quollen Blutstropfen aus der Tiefe, die das Wiesengrün färbten, und bald gleich rauschenden Bächen im schäumenden Strom zusammensprudelten, der über die Ebene brauste. Immer stärker, immer höher stürmten seine Wellen, und aus dem zischenden gärenden Blut hob bald ein fürchterlicher riesiger Drache sein entsetzliches Haupt empor. Bald tauchte der glühende schuppige Schlangenleib aus den Blutwellen, und mit den schwarzen Fittichen gewaltig rauschend, daß, wie vor dem mächtigen Orkan, die Wälder sich beugten, flog der Drache auf in die Lüfte, und er faßte den Tyrannen mit den spitzigen Krallen, die er tief in seine Brust eingrub. – Da schrie der Tyrann, von dem gräßlichen Schmerz gepackt, auf im Krampf der Verzweiflung, daß seine Stimme im heulenden Mißton durch des Sturmes Brausen gellte, aber es erscholl wie Posaunen von oben herab:
»Erdenwurm! der du dich erhoben aus dem Staube – wähntest du nicht vermessen, die Macht zu sein, die den Schmerz, die den Tod sendet? – Erdenwurm, die Stunde der Erkenntnis, der Vergeltung ist da! – Aus denen, die du opfertest im frevelnden Hohn, wurde die Qual geboren, die dich zerfleischt im ewigen Jammer!«
Nun umschlang, fester und fester sein Gewinde schnürend, der Drache den Tyrannen, und überall gingen aus seinem Leibe spitze glühende Krallen hervor, die er wie Dolche in das Fleisch des Tyrannen schlug. Da wand der Tyrann, wie durch namenlose Folter verrenkt, das Haupt empor, und sah über sich die in blendendem Funkeln strahlende Sonne, den Fokus des ewigen Verhängnisses, und entsetzlicher, schneidender wurde der heulende Jammer:
»Erlösung – Erlösung von dieser Qual – Tod – Ruhe in der tiefsten Tiefe der Erde!«
Da erscholl aus dem Fokus aufs neue die Stimme im Posaunenton:
»Entarteter! Verworfener! – die Erde ist nicht deine Heimat, die dir Ruhe giebt, denn nur dem Menschen, den du frech verhöhntest, ist es vergönnt, in ihrem Schooße zu ruhen, bis er durchstrahlt vom ewigen Lichte emporkeimt zum hohem Sein, aber im ödem Raum ist dein Sein ewige Qual.«
»Ach, nur Linderung, nur Trost in meinem Jammer,« heulte der Tyrann.
»Schau herab,« sprach die Stimme: »ob du in eines Menschen Brust Trost für dich finden magst, und deine Qual soll gelindert sein!«
Da trug das Ungeheuer den Tyrannen tiefer herab zur Erde, und es rauschten im nächtlichen Dunkel finstere gräßliche Gestalten – Nero – Dschingiskhan – Tilly – Alba waren unter ihnen, sie schauten mit tiefem Entsetzen die Marter des Tyrannen und dumpf murmelten ihre Stimmen: »was ist unsere Qual gegen seine Marter, denn uns ward noch Trost von der Erde, der wir angehörten.«
Der Tyrann schaute um sich im wahnsinnigen Verlangen, aber öde blieb es auf der Ebene.
»Ist denn in keines Menschen Brust Trost für meine Qual!« schrie er in gräßlicher Verzweiflung, aber seine Stimme verhallte in den weiten Gründen, und kein menschlicher Ton des Trostes auf der ganzen weiten Erde unterbrach das dumpfe Schweigen der furchtbaren Öde.
Da faßte ihn gewaltiger der Drache, und bohrte tiefer die glühenden Krallen in seine Brust, daß schrecklicher das Geheul seines namenlosen Jammers der wütendsten Verzweiflung durch die Lüfte raste, aber aus dem Fokus strahlte die Posaunenstimme:
»Für dich kein Trost auf der Erde, der du im frevelnden Hohn entsagtest. Ewig ist die Vergeltung und deine Qual.«
Als ich, wie aus schwerem Traum erwacht, die Ruinen verließ, hatte sich schon tiefe Dämmerung über die Flur gelegt; der Raub schlich gierig spähend dem Morde nach – winselnde Sterbende wurden geplündert. Es hielt schwer durch den Schlag zu kommen, denn der Tumult herein- und herausziehender Soldaten drückte die Menschen zusammen. – Noch hallte die Stimme der ewigen Macht, die das Urteil über den Verdammten gesprochen, in meiner Brust, als ich schon in friedlicher Wohnung von den Schrecknissen des Tages ausrastete. – Ruhiger wurde es endlich in meiner Seele, und bald war es mir, als sei das glänzende Sternbild der Dioskuren segensreich über der Erde aufgegangen, die erquickt den mütterlichen Schooß öffnete, um die Früchte des Friedens in nie versiegendem Reichtum zu spenden. Ich erkannte die strahlenden Helden, die Söhne der Götter: – Alexander und Friedrich Wilhelm!
herausdebouchiert:
DEBAUCHIEREN lehnwort aus frz. débaucher; besonders im militärischen sinne
früher soviel wie zur desertion verleiten
Deutsches Wörterbuch
Devisen-Korps: Korps aus Porzellanfiguren; auch Bezeichnung für Figuren aus Zucker und Backwerk, die kleine Zettel mit Sinnsprüchen enthielten.
en quarré plain:
Ein Karree (von französisch Carré, „Quadrat“) war im Militärwesen vom 17.
bis ins 19. Jahrhundert hinein eine Gefechtsformation der Infanterie mit
nach vier Seiten hin geschlossener Front zur Abwehr von Kavallerie. Das
Karree bot einen wirkungsvollen Schutz gegen Kavallerieangriffe, da es keine
ungeschützten Flanken aufwies und die Pferde vor den aufgepflanzten
Bajonetten zurückschreckten.
Wikipedia
Tungusen: die
Angehörigen der (mandschu-)tungusischen Völker; der Begriff Tungusische
Völker ist eine zusammenfassende Bezeichnung für Völker, Ethnien und
Bevölkerungsgruppen, bei deren Vorfahren tungusische Sprachen in Gebrauch
waren oder sind. Während einige Ethnien bis heute noch diese Sprachen
sprechen, verwenden deutlich mehr als 90 % der Bevölkerung tungusischer
Herkunft Chinesisch und andere Sprachen (Mongolisch, Russisch).
Wikipedia
Friseurs: von franz. frisé „gekräuselt“, Haarkünstler
Harlekins: Der
Harlekin, abgeleitet vom italienischen Arlecchino, das wiederum auf die
altfranzösischen Wörter (h)arlekin, (h)erlekin, (h)ellequin, harlequin und
ähnliche aus dem 12. Jahrhundert zurückgeht, ist eine Bühnenfigur, die als
jahrhundertealtes und europaweites Phänomen zu betrachten ist. Sie wird mit
der Commedia dell’arte der Renaissance, der Commedia Italiana und anderen
Ausprägungen des „Comödien-Stils“ in Verbindung gebracht.
Wikipedia
Kupidos:
Amor, oft auch Cupido genannt, ist in
der römischen Mythologie der Gott und
die Personifikation der Liebe (genauer: des Sichverliebens) und wird als
halbwüchsiger Knabe nicht ohne schalkhafte Bosheit aufgefasst, der mit
seinen Pfeilen ins Herz trifft und dadurch die Liebe erweckt.
Wikipedia
braune Männer und Frauen aus Thorn: Lebkuchfiguren
----(MeisterDrucke-68497.jpg)
Carle Vernet: Marchand de Pain d'Epice. Lithographie, um 1820
„Ein Pferd – ein Pferd – ein Königreich für ein Pferd!“: Die Redewendung stammt aus William Shakespeares Drama „Richard III“, in dem der König auf der Flucht sagt: „A horse! A horse! My kingdom for a horse!“, da sein eigenes Pferd getötet wurde.
Tirailleurs: Tirailleure (frz. Schützen)
sind in aufgelöster Ordnung kämpfende Mannschaften der Infanterie, auch
Plänkler genannt. Sie gehören zur leichten Infanterie. Als erstes Land
stellte Frankreich während der Französischen Revolution Tirailleur-Einheiten
auf.
Wikipedia
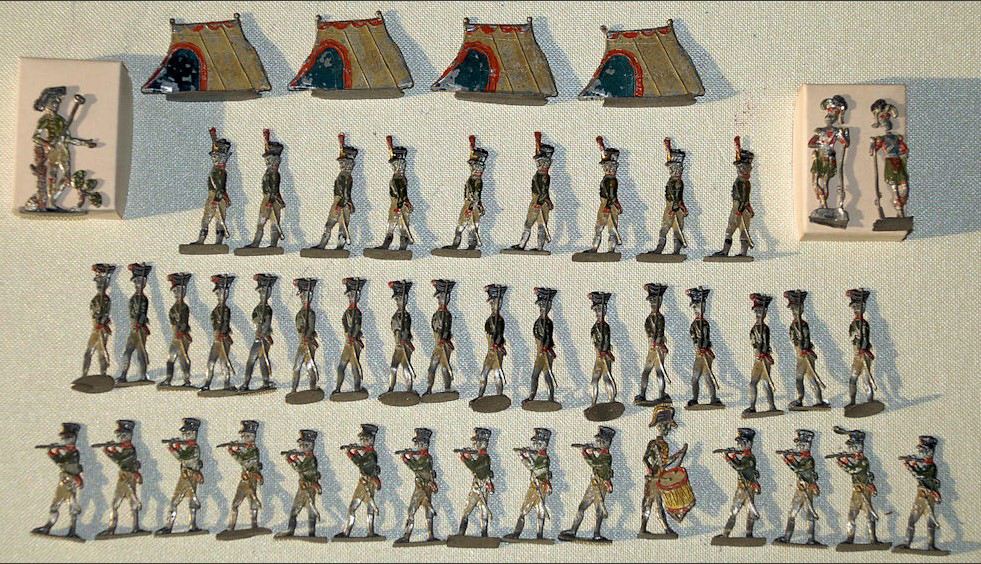
Ein Satz Zinnfiguren mit Zubehör für ein Feldlager
Zu den bekanntesten und weitverbreiteten
Karikaturen der damaligen Zeit gehörte eine anonyme Zeichnung, die Napoleon als
Nußknacker zeigt. Sie existiert in mehreren Varianten. Napoleon beißt sich an
Leipzig die Zähne aus, wie man der Schrift auf der Nuß entnehmen kann. Einige
Zähne liegen bereits am Boden, zusammen mit Knochen und Schädeln, die an die
Toten der Völkerschlacht im Oktober 1813 bei Leipzig erinnern. Auch in Hoffmanns
Märchen ergeht es dem Nußknacker so: Er verliert, als ihm der kleine
militärische Fritz die „größten und härtsten“ Nüsse zu knacken gibt, gleich
anfangs drei seiner Zähne. „Will Nußknacker seyn, und hat kein ordentliches
Gebiß – mag wohl auch sein Handwerk gar nicht verstehn“, so doppelsinnig
kommentiert Fritz die Katastrophe.
Wulf Segebrecht 2009, S. 68.

Der Pariser Nussknacker (Napoleon beißt sich an der harten Nuss der Schlacht zu Leipzig 1813 die Zähne aus) Anonyme Radierung, koloriert, um 1814.
Napoleon als „Nußknacker“, Napoleon als „Ratten“- bzw. Mausekönig! Es ist undenkbar, daß E. T. A. Hoffmann ebenso wie sein erwachsenes Lesepublikum nicht an die populären Karikaturen gedacht haben sollte, auf denen Napoleon als Nußknacker und als Rattenkönig dargestellt worden ist. Mit beiden Bezeichnungen des Titels seines Märchens „Nußknacker und Mausekönig“ erregte E. T. A. Hoffmann bei seinem zeitgenössischen Publikum, dem diese Bezeichnungen aus der politischen Bildpublizistik als napoleonkritische Figuren völlig geläufig waren, Aufmerksamkeit und weckte entsprechende Erwartungen. Freilich galt dies nur für die erwachsenen Leser, die Anteil nahmen an den weltgeschichtlichen Ereignissen ihrer Zeit. Für die Kinder dagegen wurden die Ratten zu kaum harmloseren Mäusen, sie sahen in dem Mausekönig den bösen Antipoden des Nußknackers, den es zu besiegen galt; und der Nußknacker war für sie nur ein Gebrauchsgegenstand oder ein Spielzeug, dem sie Sympathie entgegenbringen und einen Platz in ihrer Welt einräumen konnten. Doch auch diese Phantasiewelt der Kinder trotz aller Marzipan- und anderer Lustbarkeiten geprägt von Kampf und Krieg, Verletzungen und Tötungen Es ist keine heile Welt die sie erfahrene.
Die beiden ‚Rollen‘ Napoleons, als Nußknacker und als Mäuse- bzw.
Rattenkönig, werden in Hoffmanns Märchen zwei einander bekämpfenden
Positionen umgeformt. Der in der Schlacht unterlegene Napoleon (ob man dabei
an Leipzig denkt oder an Waterloo) findet im Märchen als scheiternder
Nußknacker das Mitleid und die Liebe der kleinen Marie, und ausgerechnet der
unschädlich gemachte, auf die Insel Helena verbannte Napoleon wird im
Märchen als Mausekönig zu einem gefährlichen Gegner, der erst noch besiegt
werden muß. Es herrscht im Märchen also das Prinzip der Umkehrung der
zeitgeschichtlichen Rollen Napoleons. In dieser Form also, als ironische
Umkehrung, ist Zeitgeschichte im Märchen präsent. Napoleon ist ein bloßer
Nußknacker, ein Spielzeug, aber er ist eben auch alles andere als ein
Spielzeug, nämlich als Mausekönig ein „Untier“.
Wulf Segebrecht 2009, S. 70f.
Zum Verständnis des Märchens Nußknacker und
Mausekönig, in dem der Krieg eine so dominierende Rolle spielt, ist es
notwendig, an eine Auseinandersetzung Hoffmanns mit den kriegerischen
Ereignissen seiner Zeit zu erinnern, die bisher in diesem Zusammenhang so gut
wie völlig unberücksichtigt geblieben ist; ich meine seine antinapoleonischen
Karikaturen aus dem Jahr 1814, d.h. aus der Zeit nach der endgültigen Niederlage
Napoleons und seiner Verbannung auf die Insel Elba im Mittelmeer. Auf die
Napoleon-Karikaturen E. T. A. Hoffmanns und auf einige Napoleon-Karikaturen seiner
Zeitgenossen einzugehen, besteht umso mehr Veranlassung, als unter ihnen sowohl
der Nußknacker als auch der Mäuse- bzw. Rattenkönig eine exponierte Stellung
einnahmen. Das wußten sicher nicht die Kinder, aber doch jedenfalls die
Erwachsenen, an die das Märchen eben doch auch adressiert war. Hoffmanns eigene
antinapoleonische Karikaturen sind nur zum Teil überliefert. Er hat sie
überwiegend im März und April 1814 in Leipzig gezeichnet, als ihm die Stelle als
Musikdirektor bei der Theatertruppe von Joseph Seconda gekündigt worden war und
er wieder einmal dringend Geld benötigte. Seine karikaturistischen Zeichnungen,
so weit wir sie kennen, sind außerordentlich inhaltsreich und präzise bis ins
Detail, sie erzählen mehrere Geschichten zugleich und bezeugen, daß er über die
politischen Verhältnisse in Europa glänzend informiert war.
Wulf Segebrecht 2009, S. 66.

E.T.A. Hoffmann: Die Exorcisten. Der Teufel, welcher die Dame Gallia lange besessen, wird durch verbündete Kraft endlich ausgetrieben, und fährt in die Gergesener Heerden. Industrie-Comptoir in Leipzig [1814].
Sie sind für das Märchen Nußknacker und Mausekönig insofern relevant, als sie das lebhafte Interesse des Autors Hoffmann am Kriegsgeschehen und an seinen politischen Folgen bezeugen. Hoffmanns Karikatur Die Exorcisten fügt dem Titel die Erläuterung hinzu: „Der Teufel, welcher die Dame Gallia lange besessen, wird durch verbündete Kraft endlich ausgetrieben, und fährt in die Gergesener Heerden“. Dort waren nach Matth. 8, 28ff. die Teufel, von denen Jesus zwei Besessene befreit hatte, mit seiner Erlaubnis in eine Sauherde gefahren, die sich daraufhin besinnungslos ins Meer gestürzt hatte. Man sieht diese Herde links im Hintergrund. Die Schweine tragen den roten Federbusch, der seit 1811 nur noch von höheren und höchsten Offizieren der französischen Armee getragen werden durfte. Hoffmann hat diesen roten Federbusch auch dem Nußknacker in der Titelzeichnung zu seinem Märchen zugebilligt. Die Dame Gallia (Frankreich) ist einigermaßen entkräftet, der Brite fühlt ihr den Puls, die anderen Koalitionäre sind mit der Vertreibung des Teufels beschäftigt. Den ausgetriebenen Teufel, also Napoleon sieht man bereits in den Lüften, ausgestattet mit Pferdefuß und Vogelkralle, Libellenflügeln und langem Schwanz, natürlich mit den obligatorischen Hörnern.

ETA Hofffmann: Die Dame Gallia bezahlt, nachdem sie wieder genesen, ihren Aerzten die Rechnung. Industrie-Comptoir des Adam Friedrich Gotthelf Baumgärtner, Leipzig [1814].
Das nächste Bild ist betitelt: Die Dame Gallia bezahlt, nachdem sie wieder genesen, ihren Aerzten die Rechnung, schließ also unmittelbar an das vorhergehende Bild an. Die Eintracht („Concordia“), unter deren Banner die Szene steht, ist nur das ironische Wort für das Profitklück, mit dem die Sieger von Waterloo die Reparationsleistungen Frankreichs, hier beschönigend „Geschenke“ genannt, einsacken. Im Falle Preußens (ganz rechts im Bild) sind das die Gebietsrückgaben Westphalen und Danzig, aus denen die blauweißroten französischen Bienen, die sich dort eingenistet hatten, vertrieben werden.
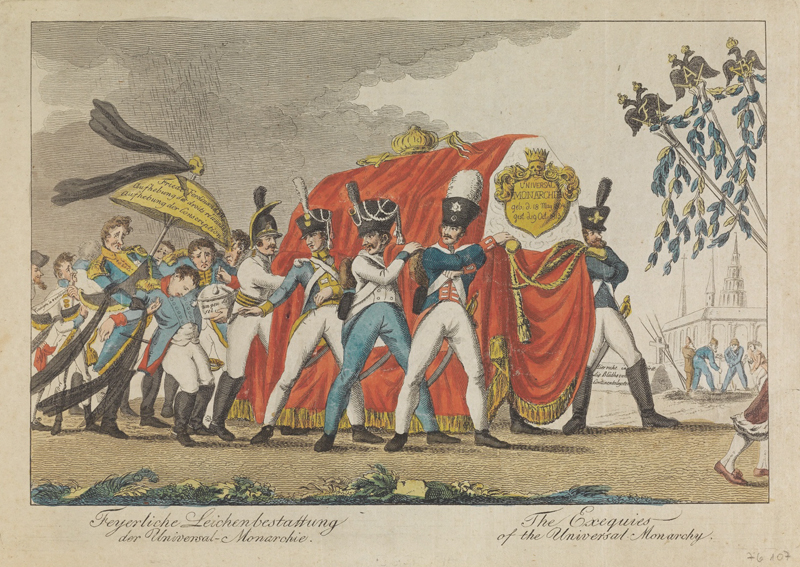
Hoffmann, E. T. A.: Feyerliche Leichenbestattung der Universal-Monarchie. The Exequies of the Universal Monarchy. Joachim'sche Buchhandlung, Leipzig 1814
Das dritte Bild Hoffmanns schließlich stellt die
Feyerliche Leichenbestattung der Universal-Monarchie Napoleons dar; es ist auch
in englischer Sprache betitelt, wohl in der Absicht des Verlegers, es auch in
England vertreiben zu können, wo James Gillray die künstlerisch hochwertigsten
und vorbildlichen Napoleon-Karikaturen geschaffen hatte; eine Verbeugung auch
vor ihm. Die Lebensdaten des zu Grabe getragenen Anspruchs, in Europa eine
Universalmonarchie zu erachten, beziehen sich auf Napoleons Einsetzung als
Kaiser (18. Mai 1804) und auf den letzten Tag der Völkerschlacht (19. Oktober
1813). Napoleon selbst folgt dem Sarg als sichtlich gebrochener Mann; er muß
gestützt werden, und ein Begleiter reicht ihm zur Stärkung ausgerechnet einen
Löffel mit Salz. Es ist das Salz der Ironie, und der Ironiker trägt
offensichtlich die Züge E. T. A. Hoffmanns. Im rechten Hintergrund wird das Grab
ausgehoben, und dem Grabstein sowie weiteren Inschriften auf dem Bild kann man
entnehmen was alles zusammen mit der Universalmonarchie zu Grabe getragen wird:
die Kontinentalsperre, die Konskription (Soldatenaushebung) und sogar der Code
Napoleon.
Wulf Segebrecht 2009, S. 67f.
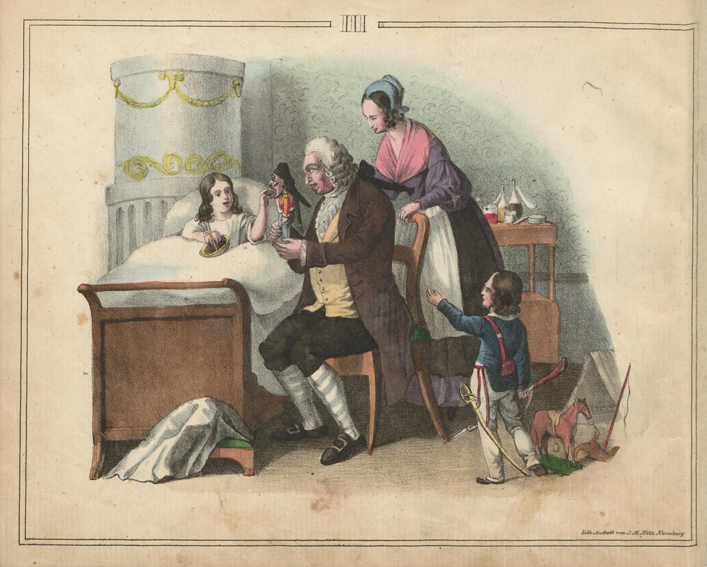
|
Die Krankheit Als Marie wie aus tiefem Todesschlaf erwachte, lag sie in ihrem Bettchen und die Sonne schien hell und funkelnd durch die mit Eis belegten Fenster in das Zimmer hinein. Dicht neben ihr saß ein fremder Mann, den sie aber bald für den Chirurgus Wendelstern erkannte. Der sprach leise: „Nun ist sie aufgewacht!“ Da kam die Mutter herbei und sah sie mit recht ängstlich forschenden Blicken an. „Ach liebe Mutter“, lispelt die kleine Marie: „sind denn nun die häßlichen Mäuse alle fort, und ist denn der gute Nußknacker gerettet?“ „Sprich nicht solch albernes Zeug, liebe Marie“, erwiderte die Mutter, „was haben die Mäuse mit dem Nußknacker zu tun. Aber du böses Kind, hast uns allen recht viel Angst und Sorge gemacht. Das kommt davon her, wenn die Kinder eigenwillig sind und den Eltern nicht folgen. Du spieltest gestern bis in die tiefe Nacht hinein mit deinen Puppen. Du wurdest schläfrig, und mag es sein, daß ein hervorspringendes Mäuschen, deren es doch sonst hier nicht gibt, dich erschreckt hat; genug du stießest mit dem Arm eine Glasscheibe des Schranks ein und schnittest dich so sehr in den Arm, daß Herr Wendelstern, der dir eben die noch in den Wunden steckenden Glasscherbchen herausgenommen hat, meint, du hättest, zerschnitt das Glas eine Ader, einen steifen Arm behalten, oder dich gar verbluten können. Gott sei gedankt, daß ich um Mitternacht erwachend, und dich noch so spät vermissend, aufstand, und in die Wohnstube ging. Da lagst du dicht neben dem Glasschrank ohnmächtig auf der Erde und blutetest sehr. Bald wär ich vor Schreck auch ohnmächtig geworden. Da lagst du nun, und um dich her zerstreut erblickte ich viele von Fritzens bleiernen Soldaten und andere Puppen, zerbrochene Devisen, Pfefferkuchmänner; Nußknacker lag aber auf deinem blutenden Arme und nicht weit von dir dein linker Schuh.“ „Ach Mütterchen, Mütterchen“, fiel Marie ein: „sehen Sie wohl, das waren ja noch die Spuren von der großen Schlacht zwischen den Puppen und Mäusen, und nur darüber bin ich so sehr erschrocken, als die Mäuse den armen Nußknacker, der die Puppenarmee kommandierte, gefangennehmen wollten. Da warf ich meinen Schuh unter die Mäuse und dann weiß ich weiter nicht was vorgegangen.“ Der Chirurgus Wendelstern winkte der Mutter mit den Augen und diese sprach sehr sanft zu Marien: „Laß es nur gut sein, mein liebes Kind! – beruhige dich, die Mäuse sind alle fort und Nußknackerchen steht gesund und lustig im Glasschrank.“ Nun trat der Medizinalrat ins Zimmer und sprach lange mit dem Chirurgus Wendelstern; dann fühlte er Mariens Puls und sie hörte wohl, daß von einem Wundfieber die Rede war. Sie mußte im Bette bleiben und Arzenei nehmen und so dauerte es einige Tage, wiewohl sie außer einigem Schmerz am Arm sich eben nicht krank und unbehaglich fühlte. Sie wußte, daß Nußknackerchen gesund aus der Schlacht sich gerettet hatte, und es kam ihr manchmal wie im Traume vor, daß er ganz vernehmlich, wiewohl mit sehr wehmütiger Stimme sprach: „Marie, teuerste Dame, Ihnen verdanke ich viel, doch noch mehr können Sie für mich tun!“ Marie dachte vergebens darüber nach, was das wohl sein könnte, es fiel ihr durchaus nicht ein. – Spielen konnte Marie gar nicht recht, wegen des wunden Arms, und wollte sie lesen, oder in den Bilderbüchern blättern, so flimmerte es ihr seltsam vor den Augen, und sie mußte davon ablassen. So mußte ihr nun wohl die Zeit recht herzlich lang werden, und sie konnte kaum die Dämmerung erwarten, weil dann die Mutter sich an ihr Bett setzte, und ihr sehr viel Schönes vorlas und erzählte. Eben hatte die Mutter die vorzügliche Geschichte vom Prinzen Fakardin vollendet, als die Türe aufging, und der Pate Droßelmeier mit den Worten hineintrat: „Nun muß ich doch wirklich einmal selbst sehen, wie es mit der kranken und wunden Marie zusteht.“ Sowie Marie den Paten Droßelmeier in seinem gelben Röckchen erblickte, kam ihr das Bild jener Nacht, als Nußknacker die Schlacht wider die Mäuse verlor, gar lebendig vor Augen, und unwillkürlich rief sie laut dem Obergerichtsrat entgegen: „O Pate Droßelmeier, du bist recht häßlich gewesen, ich habe dich wohl gesehen, wie du auf der Uhr saßest, und sie mit deinen Flügeln bedecktest, daß sie nicht laut schlagen sollte, weil sonst die Mäuse verscheucht worden wären – ich habe es wohl gehört, wie du dem Mausekönig riefest! – warum kamst du dem Nußknacker, warum kamst du mir nicht zu Hülfe, du häßlicher Pate Droßelmeier, bist du denn nicht allein schuld, daß ich verwundet und krank im Bette liegen muß?“ – Die Mutter fragte ganz erschrocken: „Was ist dir denn, liebe Marie?“ Aber der Pate Droßelmeier schnitt sehr seltsame Gesichter, und sprach mit schnurrender, eintöniger Stimme: „Perpendikel mußte schnurren – picken – wollte sich nicht schicken – Uhren – Uhren – Uhrenperpendikel müssen schnurren – leise schnurren – schlagen Glocken laut kling klang – Hink und Honk, und Honk und Hank – Puppenmädel sei nicht bang! – schlagen Glöcklein, ist geschlagen, Mausekönig fortzujagen, kommt die Eul im schnellen Flug – Pak und Pik, und Pik und Puk – Glöcklein bim bim – Uhren – schnurr schnurr – Perpendikel müssen schnurren – picken wollte sich nicht schicken – Schnarr und schnurr, und pirr und purr!“ – Marie sah den Paten Droßelmeier starr mit großen Augen an, weil er ganz anders, und noch viel häßlicher aussah, als sonst, und mit dem rechten Arm hin und her schlug, als würd er gleich einer Drahtpuppe gezogen. Es hätte ihr ordentlich grauen können vor dem Paten, wenn die Mutter nicht zugegen gewesen wäre, und wenn nicht endlich Fritz, der sich unterdessen hineingeschlichen, ihn mit lautem Gelächter unterbrochen hätte. „Ei, Pate Droßelmeier“, rief Fritz, „du bist heute wieder auch gar zu possierlich, du gebärdest dich ja wie mein Hampelmann, den ich längst hinter den Ofen geworfen.“ Die Mutter blieb sehr ernsthaft, und sprach: „Lieber Herr Obergerichtsrat, das ist ja ein recht seltsamer Spaß, was meinen Sie denn eigentlich?“ „Mein Himmel!“ erwiderte Droßelmeier lachend, „kennen Sie denn nicht mehr mein hübsches Uhrmacherliedchen? Das pfleg ich immer zu singen bei solchen Patienten wie Marie.“ Damit setzte er sich schnell dicht an Mariens Bette, und sprach: „Sei nur nicht böse, daß ich nicht gleich dem Mausekönig alle vierzehn Augen ausgehackt, aber es konnte nicht sein, ich will dir auch statt dessen eine rechte Freude machen.“ Der Obergerichtsrat langte mit diesen Worten in die Tasche, und was er nun leise, leise hervorzog, war – der Nußknacker, dem er sehr geschickt die verlornen Zähnchen fest eingesetzt, und den lahmen Kinnbacken eingerenkt hatte. Marie jauchzte laut auf vor Freude, aber die Mutter sagte lächelnd: „Siehst du nun wohl, wie gut es Pate Droßelmeier mit deinem Nußknacker meint?“ „Du mußt es aber doch eingestehen, Marie“, unterbrach der Obergerichtsrat die Medizinalrätin, „du mußt es aber doch eingestehen, daß Nußknacker nicht eben zum besten gewachsen, und sein Gesicht nicht eben schön zu nennen ist. Wie sotane Häßlichkeit in seine Familie gekommen und vererbt worden ist, das will ich dir wohl erzählen, wenn du es anhören willst. Oder weißt du vielleicht schon die Geschichte von der Prinzessin Pirlipat, der Hexe Mauserinks und dem künstlichen Uhrmacher?“ „Hör mal“, fiel hier Fritz unversehens ein, „hör mal, Pate Droßelmeier, die Zähne hast du dem Nußknacker richtig eingesetzt, und der Kinnbacken ist auch nicht mehr so wackelig, aber warum fehlt ihm das Schwert, warum hast du ihm kein Schwert umgehängt?“ „Ei“, erwiderte der Obergerichtsrat ganz unwillig, „du mußt an allem mäkeln und tadeln, Junge! – Was geht mich Nußknackers Schwert an, ich habe ihn am Leibe kuriert, mag er sich nun selbst ein Schwert schaffen wie er will.“ „Das ist wahr“, rief Fritz, „ist's ein tüchtiger Kerl, so wird er schon Waffen zu finden wissen.“ „Also Marie“, fuhr der Obergerichtsrat fort, „sage mir, ob du die Geschichte weißt von der Prinzessin Pirlipat?“ „Ach nein“, erwiderte Marie, „erzähle, lieber Pate Droßelmeier, erzähle!“ „Ich hoffe“, sprach die Medizinalrätin, „ich hoffe, lieber Herr Obergerichtsrat, daß Ihre Geschichte nicht so graulich sein wird, wie gewöhnlich alles ist, was Sie erzählen?“ „Mitnichten, teuerste Frau Medizinalrätin“, erwiderte Droßelmeier, „im Gegenteil ist das gar spaßhaft, was ich vorzutragen die Ehre haben werde.“ „Erzähle, o erzähle, lieber Pate“, so riefen die Kinder, und der Obergerichtsrat fing also an: |
Wundfieber: Folgeerscheinung eines Wundinfektion Die
gesamte Familie Stahlbaum ist derart in der bürgerlichen Realität verhaftet,
dass sie Maries Geschichten für Kinderpossen oder das Ergebnis des
Wundfiebers erachten. Die Eltern und die ältere Schwester Luise sind als
bürgerlich-prosaische Einheit zu begreifen, die den Figuren, die für das
Wunderbare empfänglich sind, gegenüberstehen und ihre Aussagen
rationalisieren. Die Rollenverteilung in der Familie ermöglicht also die
Ambivalenz des Märchens, da durch die divergenten Standpunkte erst eine Polyperspektivität und
somit das Fluktuieren zwischen zwei Welten möglich wird. Geschichte vom Prinzen Fakardin: Der Nussknacker ist in vierzehn Kapitel unterteilt, vielleicht damit er in Teilen zwischen Heiligabend und Epiphanie gelesen werden kann. Den zentralen Teil, die Kapitel 7, 8 und 9, bildet das „Märchen von der harten Nuss“, das Pate Drosselmeier Marie an drei Abenden erzählt, während sie sich von ihrer Weihnachtsverletzung erholt. Sie konnte nicht spielen und war nicht konzentriert genug, um selbst zu lesen, also hat Mutter ihr vorgelesen und ihr Geschichten erzählt. Sie hat gerade die Erzählung von Prinz Facardin abgeschlossen. Diese Geschichte bezieht sich Hoffmann immer wieder. Es wurde von Graf Antoine Hamilton (1646-1720) verfasst, einem französischen Schriftsteller schottischer Abstammung, und trägt den Titel Les quatre Facardins; veröffentlicht wurde sie erst posthum im Jahr 1730. Das Märchen ist in zwei deutschen Ausgaben von Hamiltons Märchen enthalten, denen Hoffmann vermutlich in seiner Kindheit oder Jugend begegnet ist – Drei hüpsche kurzweilige Mährlein, übersetzt von Görg Bider (d.h. W. C. S. Mylius) (Halle: Hendel, 1777) und Feenmährchen des Grafen Hamilton (Gotha, 1790) in Band 2 von Friedrich Justin Bertuchs Blaue Bibliothek aller Nationen. Es handelt sich um ein ein langes und sehr kompliziertes literarisches Märchen, das im Gefolge von Antoine Gallands Mille et une nuits (1704-17) geschrieben wurde, der ersten Übersetzung von Tausendundeiner Nacht in eine europäische Sprache, das einen ähnlichen orientalischen Erzählkontext hat. Er ist voller bizarrer Abenteuern, die so weit voneinander entfernt sind wie der Atlasgebirge, das Rote Meer und Trapezunt, und gibt vor, die Geschichte von vier Helden zu erzählen, von denen jeder den außergewöhnlichen Namen Facardin trägt. Nach etwa 150 Seiten bricht die Erzählung jedoch mit der Begründung ab: «Mais je crois qu'il est bon de remettre le reste du récit que faisoit le prince de Trébizonde, à la seconde partie de ces mémoires». (Aber ich denke, es ist gut, den Rest der Geschichte des Prinzen von Trapezunt auf den zweiten Teil dieser Memoiren zu verschieben.)
Schöne Historia von den ritterlichen und weidlichen Thaten vier stattlicher,
kekker iunger Gesellen, allzumal die Fakkardine benamst. Ser grauerlich und
schauerlich zulesen, dennoch aber dabei gar lustiglich und lieblich.
Sonderlich anlangend die affenteuerlichen, naupengeheuerlichen Begebnisse.
Ritter Fakkardins vom Berge, sonst auch der hüpsche Freisame geniemst. Noch
'ne Beilage zu Tausend und Einer Nacht. In: Feenmährchen des Grafen Hamilton.
Drei hüpsche kurzweilige
Märlein. Gestellt und beschrieben durch'n Grafen Anton Hamilton. Nunmehro
aber ihro sonderbaren Lieblichkeit halber aus dem Franzschen in's Teutsche
gedolmetscht, durch Görg Bider, dermalen Boten zu Lauchstädt, weiland erbern
Schustergesellen. Begreifend: Historiam der Flördepina, Historiam der vier
Fakkardine und Historiam 'nes Widders; Hintendran ein Vokabularius. Im Jahre
nach unsers HERRN Gepurt, Tausend Siebenhundert Siebenzig Sieben, S.
167-342. Zu diesem Zeitpunkt hat Hamilton seinen Lesern nur drei Episoden der Facardins vorgestellt und wenig Hinweise darauf gegeben, wie die Fäden der Geschichte zufrieden stellend miteinander verbunden werden könnten. Ein Redakteur meinte, die Erzählung sei als Satire auf die Absurditäten des französischen literarischen Märchens gedacht gewesen, ähnlich wie Cervantes in Don Quijote die Sitten des Rittertums verspottete; aber es hat nicht das Flair und den Humor von Cervantes. Hamiltons Geschichte wurde sicherlich nicht für Kinder geschrieben, die so jung sind wie die siebenjährige Marie. Nicht nur, dass die komplizierte Handlung für ein Kind in diesem Alter schwer zu verstehen wäre, sondern sie enthält auch eine Reihe von primär erotischen Episoden, die ein Kind irritieren würden. Darüber hinaus wirken die Übertreibungen traditioneller Märchenmotive und die erstaunliche Langatmigkeit eher kalkuliert als organisch.
Die vier Farcadine. Ein Mährchen. In: Die Blaue Bibliothek aller Nationen. Zweyter Band. Gotha: in der Ettingerschen Buchhandlung. 1790, S. 333-512. Les quatre Facardin zeichnet sich auch dadurch aus, dass es eine eingebettete Geschichte enthält, in der Facardin, der Prinz von Trapezunt, den zweiten Facardin trifft und sich einen Bericht über seine Abenteuer anhört. Wenn dies geschehen ist, verflechten sich die beiden Geschichten. Auch in Hoffmanns Erzählung werden das Thema und die Figuren des „Märchens von der harten Nuss“ in die Fortsetzung des Kampfes zwischen den Mäusen und den Spielzeugen aufgenommen. Bezeichnend ist auch, dass die harte Nuss, wie auch Les quatre Facardins, zum Ende kommt, bevor man sagen kann, dass die Geschichte zu Ende erzählt ist. Es gibt kein traditionelles Happy End: Der Astronom sieht einfach eine Lösung in den Sternen. Der Rest von Hoffmanns Geschichte zielt darauf ab, eine solche Lösung durch Marie und der Nussknacker zu erreichen. Eine weitere Verbindung zwischen Hamiltons und Hoffmanns Erzählungen ergibt sich aus dem Kommentar, den jeder Autor seine Zuhörer zu der eingebetteten Erzählung abgeben lässt, die sie gerade gehört haben. Bei Hamilton dreht sich dies um den Sultan und die weibliche Geschichtenerzählerin, die er sich als Zuhörerin der Geschichte der vier Facardins vorstellt, wobei er sich an Tausendundeiner Nacht orientiert. Mit Hoffmann ist es die enger eingebundene Familie Stahlbaum. Die Anspielung auf Les
quatre Facardins ist meiner Ansicht nach nicht nur eine beiläufige
Anspielung auf ein populäres literarisches Märchen. Trotz der vielen
Unterschiede zwischen Hamilton und Hoffmann in Bezug auf Länge,
Künstlichkeit und vor allem Ton ließ sich Hoffmann offensichtlich von dem
französischen Autor anregen und adaptierte einige seiner Ideen und Techniken
für seine Zwecke. Drahtpuppe: Früher wurden Gliederpuppen von einem Marionettenspieler mit Hilfe von Drähten bewegt, die an den einzelnen Gliedern befestigt sind.
Fritz: Maries älterer Bruder Fritz, der dem
Wunderbaren nicht grundsätzlich verschlossen gegenüber steht, ist selbst
allerdings nicht in der Lage, es mit eigenen Augen zu sehen; ihm gelingt
die Transzendenz in die wunderbare Sphäre nicht vollständig. Dieser Umstand
kann sowohl durch den Handlungsverlauf bestimmt sein – Marie als
Beschützerin des Nußknackers, die allein um Mitternacht Augenzeugin des
Szenarios wird – als auch dafür sprechen, dass es sich lediglich um innere
Visionen Maries handelt. Prinzessin Pirlipat: Figur aus dem „Märchen von der harten Nuß“. |

|
Das Märchen von der harten Nuß „Pirlipats Mutter war die Frau eines Königs, mithin eine Königin, und Pirlipat selbst in demselben Augenblick, als sie geboren wurde, eine geborne Prinzessin. Der König war außer sich vor Freude über das schöne Töchterchen, das in der Wiege lag, er jubelte laut auf, er tanzte und schwenkte sich auf einem Beine, und schrie ein Mal über das andere: ›Heisa! – hat man was Schöneres jemals gesehen, als mein Pirlipatchen?‹ – Aber alle Minister, Generale und Präsidenten und Stabsoffiziere sprangen, wie der Landesvater, auf einem Beine herum, und schrien sehr: ›Nein, niemals!‹ Zu leugnen war es aber auch in der Tat gar nicht, daß wohl, solange die Welt steht, kein schöneres Kind geboren wurde, als eben Prinzessin Pirlipat. Ihr Gesichtchen war wie von zarten lilienweißen und rosenroten Seidenflocken gewebt, die Äugelein lebendige funkelnde Azure, und es stand hübsch, daß die Löckchen sich in lauter glänzenden Goldfaden kräuselten. Dazu hatte Pirlipatchen zwei Reihen kleiner Perlzähnchen auf die Welt gebracht, womit sie zwei Stunden nach der Geburt dem Reichskanzler in den Finger biß, als er die Lineamente näher untersuchen wollte, so daß er laut aufschrie: ›O jemine!‹ – Andere behaupten, er habe: ›Au weh!‹ geschrien, die Stimmen sind noch heutzutage darüber sehr geteilt. – Kurz, Pirlipatchen biß wirklich dem Reichskanzler in den Finger, und das entzückte Land wußte nun, daß auch Geist, Gemüt und Verstand in Pirlipats kleinem engelschönen Körperchen wohne. – Wie gesagt, alles war vergnügt, nur die Königin war sehr ängstlich und unruhig, niemand wußte warum? Vorzüglich fiel es auf, daß sie Pirlipats Wiege so sorglich bewachen ließ. Außerdem, daß die Türen von Trabanten besetzt waren, mußten, die beiden Wärterinnen dicht an der Wiege abgerechnet, noch sechs andere, Nacht für Nacht ringsumher in der Stube sitzen. Was aber ganz närrisch schien, und was niemand begreifen konnte, jede dieser sechs Wärterinnen mußte einen Kater auf den Schoß nehmen, und ihn die ganze Nacht streicheln, daß er immerfort zu spinnen genötigt wurde. Es ist unmöglich, daß ihr, lieben Kinder, erraten könnt, warum Pirlipats Mutter all diese Anstalten machte, ich weiß es aber, und will es euch gleich sagen. – Es begab sich, daß einmal an dem Hofe von Pirlipats Vater viele vortreffliche Könige und sehr angenehme Prinzen versammelt waren, weshalb es denn sehr glänzend herging, und viel Ritterspiele, Komödien und Hofbälle gegeben wurden. Der König, um recht zu zeigen, daß es ihm an Gold und Silber gar nicht mangle, wollte nun einmal einen recht tüchtigen Griff in den Kronschatz tun, und was Ordentliches daraufgehen lassen. Er ordnete daher, zumal er von dem Oberhofküchenmeister insgeheim erfahren, daß der Hofastronom die Zeit des Einschlachtens angekündigt, einen großen Wurstschmaus an, warf sich in den Wagen, und lud selbst sämtliche Könige und Prinzen – nur auf einen Löffel Suppe ein, um sich der Überraschung mit dem Köstlichen zu erfreuen. Nun sprach er sehr freundlich zur Frau Königin: ›Dir ist ja schon bekannt, Liebchen! wie ich die Würste gern habe!‹ – Die Königin wußte schon, was er damit sagen wollte, es hieß nämlich nichts anders, als sie selbst sollte sich, wie sie auch sonst schon getan, dem sehr nützlichen Geschäft des Wurstmachens unterziehen. Der Oberschatzmeister mußte sogleich den großen goldnen Wurstkessel und die silbernen Kasserollen zur Küche abliefern; es wurde ein großes Feuer von Sandelholz angemacht, die Königin band ihre damastene Küchenschürze um, und bald dampften aus dem Kessel die süßen Wohlgerüche der Wurstsuppe. Bis in den Staatsrat drang der anmutige Geruch; der König, von innerem Entzücken erfaßt, konnte sich nicht halten. ›Mit Erlaubnis, meine Herren!‹ rief er, sprang schnell nach der Küche, umarmte die Königin, rührte etwas mit dem goldnen Szepter in dem Kessel, und kehrte dann beruhigt in den Staatsrat zurück. Eben nun war der wichtige Punkt gekommen, daß der Speck in Würfel geschnitten, und auf silbernen Rosten geröstet werden sollte. Die Hofdamen traten ab, weil die Königin dies Geschäft aus treuer Anhänglichkeit und Ehrfurcht vor dem königlichen Gemahl allein unternehmen wollte. Allein sowie der Speck zu braten anfing, ließ sich ein ganz feines wisperndes Stimmchen vernehmen: ›Von dem Brätlein gib mir auch, Schwester! – will auch schmausen, bin ja auch Königin – gib mir von dem Brätlein!‹ – Die Königin wußte wohl, daß es Frau Mauserinks war, die also sprach. Frau Mauserinks wohnte schon seit vielen Jahren in des Königs Palast. Sie behauptete, mit der königlichen Familie verwandt und selbst Königin in dem Reiche Mausolien zu sein, deshalb hatte sie auch eine große Hofhaltung unter dem Herde. Die Königin war eine gute mildtätige Frau, wollte sie daher auch sonst Frau Mauserinks nicht gerade als Königin und als ihre Schwester anerkennen, so gönnte sie ihr doch von Herzen an dem festlichen Tage die Schmauserei, und rief: ›Kommt nur hervor, Frau Mauserinks, Ihr möget immerhin von meinem Speck genießen.‹ Da kam auch Frau Mauserinks sehr schnell und lustig hervorgehüpft, sprang auf den Herd, und ergriff mit den zierlichen kleinen Pfötchen ein Stückchen Speck nach dem andern, das ihr die Königin hinlangte. Aber nun kamen alle Gevattern und Muhmen der Frau Mauserinks hervorgesprungen, und auch sogar ihre sieben Söhne, recht unartige Schlingel, die machten sich über den Speck her, und nicht wehren konnte ihnen die erschrockene Königin. Zum Glück kam die Oberhofmeisterin dazu, und verjagte die zudringlichen Gäste, so daß noch etwas Speck übrigblieb, welcher, nach Anweisung des herbeigerufenen Hofmathematikers sehr künstlich auf alle Würste verteilt wurde. – Pauken und Trompeten erschallten, alle anwesenden Potentaten und Prinzen zogen in glänzenden Feierkleidern zum Teil auf weißen Zeltern, zum Teil in kristallnen Kutschen zum Wurstschmause. Der König empfing sie mit herzlicher Freundlichkeit und Huld, und setzte sich dann, als Landesherr mit Kron und Szepter angetan, an die Spitze des Tisches. Schon in der Station der Leberwürste sah man, wie der König immer mehr und mehr erblaßte, wie er die Augen gen Himmel hob – leise Seufzer entflohen seiner Brust – ein gewaltiger Schmerz schien in seinem Innern zu wühlen! Doch in der Station der Blutwürste sank er laut schluchzend und ächzend, in den Lehnsessel zurück, er hielt beide Hände vors Gesicht, er jammerte und stöhnte. – Alles sprang auf von der Tafel, der Leibarzt bemühte sich vergebens des unglücklichen Königs Puls zu erfassen, ein tiefer, namenloser Jammer schien ihn zu zerreißen. Endlich, endlich, nach vielem Zureden, nach Anwendung starker Mittel, als da sind, gebrannte Federposen und dergleichen, schien der König etwas zu sich selbst zu kommen, er stammelte kaum hörbar die Worte: ›Zu wenig Speck.‹ Da warf sich die Königin trostlos ihm zu Füßen und schluchzte: ›O mein armer unglücklicher königlicher Gemahl! – o welchen Schmerz mußten Sie dulden! – Aber sehen Sie hier die Schuldige zu Ihren Füßen – strafen, strafen Sie sie hart – ach – Frau Mauserinks mit ihren sieben Söhnen, Gevattern und Muhmen hat den Speck aufgefressen und –‹ damit fiel die Königin rücklings über in Ohnmacht. Aber der König sprang voller Zorn auf und rief laut: ›Oberhofmeisterin, wie ging das zu?‹ Die Oberhofmeisterin erzählte, soviel sie wußte, und der König beschloß Rache zu nehmen an der Frau Mauserinks und ihrer Familie, die ihm den Speck aus der Wurst weggefressen hatten. Der Geheime Staatsrat wurde berufen, man beschloß, der Frau Mauserinks den Prozeß zu machen, und ihre sämtliche Güter einzuziehen; da aber der König meinte, daß sie unterdessen ihm doch noch immer den Speck wegfressen könnte, so wurde die ganze Sache dem Hofuhrmacher und Arkanisten übertragen. Dieser Mann, der ebenso hieß, als ich, nämlich Christian Elias Droßelmeier, versprach durch eine ganz besonders staatskluge Operation die Frau Mauserinks mit ihrer Familie auf ewige Zeiten aus dem Palast zu vertreiben. Er erfand auch wirklich kleine, sehr künstliche Maschinen, in die an einem Fädchen gebratener Speck getan wurde, und die Droßelmeier rings um die Wohnung der Frau Speckfresserin aufstellte. Frau Mauserinks war viel zu weise, um nicht Droßelmeiers List einzusehen, aber alle ihre Warnungen, alle ihre Vorstellungen halfen nichts, von dem süßen Geruch des gebratenen Specks verlockt, gingen alle sieben Söhne und viele, viele Gevattern und Muhmen der Frau Mauserinks in Droßelmeiers Maschinen hinein, und wurden, als sie eben den Speck wegnaschen wollten, durch ein plötzlich vorfallendes Gitter gefangen, dann aber in der Küche selbst schmachvoll hingerichtet. Frau Mauserinks verließ mit ihrem kleinen Häufchen den Ort des Schreckens. Gram, Verzweiflung, Rache erfüllte ihre Brust. Der Hof jubelte sehr, aber die Königin war besorgt, weil sie die Gemütsart der Frau Mauserinks kannte, und wohl wußte, daß sie den Tod ihrer Söhne und Verwandten nicht ungerächt hingehen lassen würde. In der Tat erschien auch Frau Mauserinks, als die Königin eben für den königlichen Gemahl einen Lungenmus bereitete, den er sehr gern aß, und sprach: ›Meine Söhne – meine Gevattern und Muhmen sind erschlagen, gib wohl acht, Frau Königin, daß Mausekönigin dir nicht dein Prinzeßchen entzweibeißt – gib wohl acht.‹ Darauf verschwand sie wieder, und ließ sich nicht mehr sehen, aber die Königin war so erschrocken, daß sie den Lungenmus ins Feuer fallen ließ, und zum zweitenmal verdarb Frau Mauserinks dem Könige eine Lieblingsspeise, worüber er sehr zornig war. – Nun ist's aber genug für heute abend, künftig das übrige.“ Sosehr auch Marie, die bei der Geschichte ihre ganz eignen Gedanken hatte, den Pate Droßelmeier bat, doch nur ja weiterzuerzählen, so ließ er sich doch nicht erbitten, sondern sprang auf, sprechend: „Zu viel auf einmal ist ungesund, morgen das übrige.“ Eben als der Obergerichtsrat im Begriff stand, zur Tür hinauszuschreiten, fragte Fritz: „Aber sag mal, Pate Droßelmeier, ist's denn wirklich wahr, daß du die Mausefallen erfunden hast?“ „Wie kann man nur so albern fragen“, rief die Mutter, aber der Obergerichtsrat lächelte sehr seltsam, und sprach leise: „Bin ich denn nicht ein künstlicher Uhrmacher, und sollt nicht einmal Mausefallen erfinden können.“
|
Das Märchen von der harten Nuß nimmt nicht nur innerhalb des Nußknackers eine – wortwörtlich – zentrale Stellung ein, sondern ist auch für sich genommen narrativ und strukturell besonders. Das Märchen, das vom Paten Droßelmeier erzählt wird, wird durch dieses Setting zum binnenfiktionalen seriellen Erzählen und potenziert damit auf der intradiegetischen Erzählebene (bzw. der metadiegetischen, wenn man die Rahmenhandlung berücksichtigt) die Einbettung in das ebenfalls serielle, rahmenzyklische Erzählen der Serapions-Brüder – so wie es nicht nur strukturell eine Nuss repräsentiert, sondern inhaltlich zugleich die Nußknacker-Handlung fortführt als auch vorbereitet. Droßelmeier erzählt an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Geschichte von der Prinzessin Pirlipat und ihrer Verzauberung – ein Umstand, der der Tradition der Märchentrias Tribut zu zollen scheint. Während der erste Teil die Vorgeschichte um die Königsfamilie und den Konflikt mit Frau Mauserinks darlegt, bereitet er damit nicht nur die Fortsetzungen des Märchens vor, sondern auch die Ausgangssituation für den Nußknacker (diese Lesart wird zumindest schon dadurch nahegelegt, dass der Pate Droßelmeier sein fiktionales Alter Ego eine zentrale Rolle im Binnenmärchen spielen lässt; er suggeriert damit, seine eigene Geschichte zu erzählen). In der Fortsetzung des Märchens berichtet der Pate den Kindern, wie es Frau Mauserinks gelingt, die kleine Pirlipat in einen Nußknacker zu verwandeln, und welche Anstrengungen unternommen werden, um sie aus dieser Verzauberung zu befreien. Der letzte Teil des Binnenmärchens weist dabei eine Zeitraffung auf: Fünfzehn Jahre, nachdem sich der Arkanist Droßelmeier und der Hofastronom auf die Suche nach der Nuß Krakatuk gemacht haben, kehren sie nach Nürnberg zurück und finden dort sowohl die Nuß als auch den gesuchten Jüngling. Entgegen der üblichen Märchentradition, in der der Held drei Aufgaben erfolgreich absolvieren muss, um sein ›Happy End‹ zu finden, bereitet der dritte Teil kein glückliches Ende vor. Doch genau durch diesen Bruch mit der Märchentradition gelingt es, die Handlung des Binnenmärchens als Vorgeschichte an den Nußknacker anzugliedern. Den glücklichen Ausgang der Geschichte, den die Prinzessin Pirlipat in ihrer Oberflächlichkeit verweigert, kann nun die tugendhafte Marie ihrem Nußknacker bescheren. Dabei sei auf zwei Auffälligkeiten hingewiesen: Die Verzauberung Pirlipats, die am Ende der Neffe Droßelmeier selbst erleidet, spiegelt einerseits hier nicht die Handlung des Nußknackers wider, sondern der Nußknacker wiederholt – versteht man das Märchen von der harten Nuß als Vorgeschichte – die Handlung des Binnenmärchens. Das dynamische Wechselverhältnis zwischen extra- und intradiegetischer Ebene in Nußknacker und Mausekönig erhält dadurch eine zyklische Struktur – und legitimiert somit die Frage, ob das Märchen ›kindgemäß‹ ist. Andererseits erscheinen die Titel der Kapitel besonders auffällig. Während die Überschriften der Kapitel auf der extradiegetischen Ebene auf den Inhalt verweisen, pointieren die Peritexte des Binnenmärchens die innerhalb der Nußknacker-Handlung beschriebene Erzählsituation: Das Märchen, seine Fortsetzung und sein Beschluß. Auch hier lassen sich strukturelle Parallelen zwischen Märchen und Binnenmärchen erkennen: Auch die Handlung um die Protagonistin Marie wird erzählt, vom Binnenmärchen unterbrochen, fortgesetzt und beendet. Die
vermeintlich einfache Kapitelstruktur des Nußknackers belegt bei näherer
Betrachtung eine dynamische Verwebung von Form und Inhalt. Das in 14 Kapitel
unterteilte Märchen weist selbst, passend zum Titel und zur Handlung, die
Struktur einer Nuss auf. Die
ersten sechs und die letzten fünf Kapitel rahmen – wie eine Nussschale ihren
Kern – das in drei Fortsetzungen erzählte Märchen von der harten Nuß. Nicht
nur symbolisiert damit die Struktur des Binnenmärchens seinen Inhalt,
sondern es bildet – sofern man sich für diese Lesart entscheidet – die
Vorgeschichte der Nußknacker-Handlung und somit im doppelten Sinne seinen
›Kern‹. Die harte Nuß, die es zu knacken gilt, wenn man Hoffmanns Märchen vom Nußknacker und Mausekönig verstehen will, ist der Versuch einer Vermittlung zwischen der freischwebenden Phantasie der Kinder, insbesondere Maries, und der an Kausalitäten, Rationalität und Ordnung orientierten Welt der Erwachsenen. Ein Versuch, der nicht gelingen kann, solange man nur eine Seite des Märchens im Auge hat und neben dem Plädoyer für die Phantasie die Wirklichkeit des Krieges übersieht.
Alte Liebe rostet nicht oder Beschäftigung des grossen Mannes auf der kleinen Ratten-Insel Sanct Helena.
Diejenigen, die das Märchen ausschließlich als entschlüsseltes Werk lesen,
also z.B. als Initiationsgeschichte Maries oder als ein Demonstrationsmodell
einer Psychologie des Kindes, verfehlen ebenso eine ganze Dimension des
Märchens, nämlich die des Krieges wie diejenigen die es nur als ein Produkt
ungezügelter Assoziationen lesen wollen. Die einseitigen Deutungen gehen im
Märchen nicht auf – das ist seine ‚Botschaft‘. Die Erwachsenen haben nicht
recht, wenn sie den Kindern ihre Träume ausreden wollen, aber die Kinder
haben auch nicht recht, wenn sie sich ausschließlich der Phantasie
anvertrauen. Neben der Einbettung des Nußknackers in die Rahmenhandlung der Serapions-Brüder ist auch das Märchen selbst narratologisch und strukturell interessant. Wie es für Hoffmanns Texte im Allgemeinen typisch ist, spricht auch im Märchen der Erzähler die Leser direkt an. Im Vergleich zu seinen sonstigen Ansprachen gehen diese im Nußknacker mit einer fiktionalen Repräsentation der kindlichen Rezipienten einher, wenn der Erzähler »[s]eine aufmerksame Zuhörerin Marie!« oder »[s]ein[en] kriegserfahrene[n] Zuhörer Fritz« direkt adressiert. Auch an anderer Stelle zeigt sich die zielgerichtete Ansprache, die eine identifikatorische und pädagogische Intention nahelegt: »Ich wende mich an Dich selbst, sehr geneigter Leser oder Zuhörer Fritz – Theodor – Ernst – oder wie Du sonst heißen magst«. Durch die Ansprache des Lesers und Zuhörers belegt der Erzähler ein Bewusstsein über die Umstände der Textrezeption: ältere Kinder, die das Märchen eigenständig lesen, oder aber jüngere, die es vorgelesen bekommen. Auch die immer wiederkehrende förmliche Ansprache an den »sehr geehrte[n] Leser« impliziert, dass auch die erwachsenen Rezipienten fiktional in das Rezeptionsgeschehen inkludiert werden. Um die Patientin aufzumuntern, stattet Pate Droßelmeier Marie in den folgenden Tagen Besuche ab, bei denen er ihr, Fritz und der Mutter in drei Etappen das Märchen von der harten Nuß erzählt: Das Märchen handelt vom Arkanisten und Hofuhrmacher »Christian Elias Droßelmeier«, der zu Hilfe gerufen wird, um die von der bösen Frau Mauserinks verzauberte Prinzessin Pirlipat von ihrem Fluch zu befreien. Frau Mauserinks, die Königin der Mäuse, drohte der Mutter Pirlipats, ihre hübsche Tochter zu zerbeißen, sollte sie sie und ihre Verwandtschaft nicht weiterhin mit gutem Speck aus der königlichen Küche versorgen. Der König befiehlt daraufhin, die Mäuse zu fangen und zu töten, weshalb Frau Mauserinks Rache an der Prinzessin nehmen will. Zu ihrem Schutz werden, einer Prophezeiung des Hofastronomen folgend, Wärterinnen um die Wiege der Prinzessin platziert, die jeweils eine Katze auf dem Schoß haben. Doch Frau Mauserinks gelingt es, in das Zimmer einzudringen und die Prinzessin in eine Nußknacker-Puppe zu verwandeln. Der König
beauftragt Droßelmeier, eine Lösung für dieses Problem zu finden.
Droßelmeier erstellt gemeinsam mit dem Hofastronom ein Horoskop, das besagt,
dass die Prinzessin, um aus ihrer Verzauberung befreit zu werden, »nichts zu
tun hätte, als den süßen Kern der Nuß Krakatuk zu genießen«, der ihr von
einem unrasierten Jüngling, »der niemals Stiefeln getragen«, blind gereicht
werden müsse. Nach langer Suche finden der Arkanist und der Astronom sowohl
die Nuß als auch den geeigneten Jüngling bei Droßelmeiers Bruder in
Nürnberg. Bei dem Befreiungsversuch wird zwar die Prinzessin entzaubert,
doch der Jüngling stolpert und wird seinerseits in einen Nußknacker
verwandelt, weshalb Pirlipat ihn aufgrund seiner Hässlichkeit als Bräutigam
verschmäht.
Azure:
Das Azurblau (kurz Azur), auch Bergblau oder Himmelblau genannt, ist ein
hellblauer Farbton.
Lineamente: Ein Lineament ist eine gerade oder
leicht gebogene, linienhafte Struktur, an der eine Oberfläche oder ein
Körper charakteristische Merkmale aufweist oder an der sich der Aufbau
ändert. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird als Lineament auch ein
Charakterzug bezeichnet. Früher bezeichnete man auch den Umriss, den
Gesichtszug oder auch die Linien der Hand als Lineament.
Trabanten: Trabanten (spätmhd.: drabant) waren
besonders im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit dienende Begleiter oder
Leibwächter zu Fuß. Sie dienten teils als Schutzwache fürstlicher Personen,
hoher Beamter und der Landsknechtobersten, teils als Vollstrecker ihrer
Befehle. Es war lange Zeit Sitte, sie nach spanischer Art in kurze weite
Beinkleider und ein Wams zu kleiden. Die Bewaffnung waren anfänglich
Hellebarden und der Stoßdegen. Später wurden sie auch als Kavalleristen
eingesetzt. Zeit des Einschlachtens: Im Winter wurde das Vieh zu Vorratszwecken geschlachtet.
Feuer von Sandelholz: Sandelholz ist eine
Holzart der Gattung Santalum. Das Holz ist schwer, gelb und feinkörnig und
behält im Gegensatz zu vielen anderen aromatischen Hölzern seinen Duft über
Jahrzehnte. Aus dem Holz wird Sandelholzöl gewonnen. Sandelholz gilt oft als
eines der teuersten Hölzer der Welt. Sowohl das Holz als auch das Öl
verströmen einen unverwechselbaren Duft, der seit Jahrhunderten hoch
geschätzt wird. Potentaten: Machthaber, Herrscher
gebrannte Federposen: eine Feder aus den äußere
Schwanz- und Flügelfedern der Gänse, welche so zugerichtet ist, daß mit
derselben, in Tinte getaucht, Schriftzüge gemacht werden können, indem am
Ende der Spule ein spitziger, mit einem Spalte versehener u. etwas
abgestutzter Schnabel geschnitten ist.
Arkanisten: Unter einem Arkanisten (lateinisch
arcanum ‚Geheimnis‘) verstand man im 18. und 19. Jahrhundert einen Chemiker. Lungenmus: Ragout aus der Rinds- oder Kalbslunge.
Das Hauptaugenmerk des Nussknackers liegt auf
den Feindseligkeiten zwischen den Spielzeugen und den Mäusen, wobei der
Nussknacker und der Mäusekönig ihre jeweiligen Anführer sind. Obwohl Marie
ausdrücklich gesagt wird, dass sie keine natürliche Abneigung gegen Mäuse
hat, verwandelt sich ihre anfängliche Reaktion auf sie als lächerlich
schnell in Angst und Schrecken. Hoffmann zieht sein Publikum geschickt in
die Emotionen hinein, die er hervorruft, indem er suggeriert, dass Fritz,
den er beim Namen anspricht, weggelaufen, ins Bett gesprungen wäre und sich
die Bettwäsche über den Kopf gezogen hätte. Der Mäusekönig, der aus Sand,
Mörtel und bröckelnden Ziegeln oder Steinen auftaucht, wird wie von einer
unterirdischen Kraft angetrieben. Mit seinen sieben Köpfen mit den sieben
funkelnden Kronen erinnert er nicht nur an den Drachen in einem der am
weitesten verbreiteten Volksmärchen, dem
„Drachentöter“, sondern hinter ihm
an den Drachen, der in der Offenbarung das fleischgewordene Böse darstellt. Im Volksmärchen wird der Protagonist im Kampf mit dem Drachen
verwundet und ein falscher Held versucht, die Belohnung für sich zu
beanspruchen, aber schließlich wird der wahre Drachentöter wieder eingesetzt
und heiratet die Prinzessin, die das Opfer des Drachen hätte sein sollen. In
Hoffmanns Märchen wird nicht nur der Nussknacker verwundet, sondern Marie
erleidet das gleiche Schicksal und fällt in Ohnmacht. Kurz davor gibt es
eine herrlich humorvolle Note, wenn der Nussknacker in seiner Verzweiflung
den Todesruf von König Richard III. widerhallen lässt:
„Ein Pferd – ein
Pferd – mein Königreich für ein Pferd!“ August Wilhelm Schlegels Übersetzung
ins Deutsche war 1810 erschienen, Hoffmann war also ziemlich aktuell. |

|
Fortsetzung des Märchens von der harten Nuß „Nun wißt ihr wohl, Kinder“, so fuhr der Obergerichtsrat Droßelmeier am nächsten Abende fort, „nun wißt ihr wohl Kinder, warum die Königin das wunderschöne Prinzeßchen Pirlipat so sorglich bewachen ließ. Mußte sie nicht fürchten, daß Frau Mauserinks ihre Drohung erfüllen, wiederkommen, und das Prinzeßchen totbeißen würde? Droßelmeiers Maschinen halfen gegen die kluge und gewitzigte Frau Mauserinks ganz und gar nichts, und nur der Astronom des Hofes, der zugleich Geheimer Oberzeichen- und Sterndeuter war, wollte wissen, daß die Familie des Katers Schnurr imstande sein werde, die Frau Mauserinks von der Wiege abzuhalten; demnach geschah es also, daß jede der Wärterinnen einen der Söhne jener Familie, die übrigens bei Hofe als Geheime Legationsräte angestellt waren, auf dem Schoße halten, und durch schickliches Krauen ihm den beschwerlichen Staatsdienst zu versüßen suchen mußte. Es war einmal schon Mitternacht, als die eine der beiden Geheimen Oberwärterinnen, die dicht an der Wiege saßen, wie aus tiefem Schlafe auffuhr. – Alles rundumher lag vom Schlafe befangen – kein Schnurren – tiefe Totenstille, in der man das Picken des Holzwurms vernahm! – doch wie ward der Geheimen Oberwärterin, als sie dicht vor sich eine große, sehr häßliche Maus erblickte, die auf den Hinterfüßen aufgerichtet stand, und den fatalen Kopf auf das Gesicht der Prinzessin gelegt hatte. Mit einem Schrei des Entsetzens sprang sie auf, alles erwachte, aber in dem Augenblick rannte Frau Mauserinks (niemand anders war die große Maus an Pirlipats Wiege) schnell nach der Ecke des Zimmers. Die Legationsräte stürzten ihr nach, aber zu spät – durch eine Ritze in dem Fußboden des Zimmers war sie verschwunden. Pirlipatchen erwachte von dem Rumor, und weinte sehr kläglich. ›Dank dem Himmel‹, riefen die Wärterinnen, ›sie lebt!‹ Doch wie groß war ihr Schrecken, als sie hinblickten nach Pirlipatchen, und wahrnahmen, was aus dem schönen zarten Kinde geworden. Statt des weiß und roten goldgelockten Engelsköpfchens saß ein unförmlicher dicker Kopf auf einem winzig kleinen zusammengekrümmten Leibe, die azurblauen Äugelein hatten sich verwandelt in grüne hervorstehende starrblickende Augen, und das Mündchen hatte sich verzogen von einem Ohr zum andern. Die Königin wollte vergehen in Wehklagen und Jammer, und des Königs Studierzimmer mußte mit wattierten Tapeten ausgeschlagen werden, weil er ein Mal über das andere mit dem Kopf gegen die Wand rannte, und dabei mit sehr jämmerlicher Stimme rief: ›O ich unglückseliger Monarch!‹ – Er konnte zwar nun einsehen, daß es besser gewesen wäre, die Würste ohne Speck zu essen, und die Frau Mauserinks mit ihrer Sippschaft unter dem Herde in Ruhe zu lassen, daran dachte aber Pirlipats königlicher Vater nicht, sondern er schob einmal alle Schuld auf den Hofuhrmacher und Arkanisten Christian Elias Droßelmeier aus Nürnberg. Deshalb erließ er den weisen Befehl: Droßelmeier habe binnen vier Wochen die Prinzessin Pirlipat in den vorigen Zustand herzustellen, oder wenigstens ein bestimmtes untrügliches Mittel anzugeben, wie dies zu bewerkstelligen sei, widrigenfalls er dem schmachvollen Tode unter dem Beil des Henkers verfallen sein solle. – Droßelmeier erschrak nicht wenig, indessen vertraute er bald seiner Kunst und seinem Glück und schritt sogleich zu der ersten Operation, die ihm nützlich schien. Er nahm Prinzeßchen Pirlipat sehr geschickt auseinander, schrob ihr Händchen und Füßchen ab, und besah sogleich die innere Struktur, aber da fand er leider, daß die Prinzessin, je größer, desto unförmlicher werden würde, und wußte sich nicht zu raten nicht zu helfen. Er setzte die Prinzessin behutsam wieder zusammen, und versank an ihrer Wiege, die er nie verlassen durfte, in Schwermut. Schon war die vierte Woche angegangen – ja bereits Mittwoch, als der König mit zornfunkelnden Augen hineinblickte, und mit dem Szepter drohend rief: ›Christian Elias Droßelmeier, kuriere die Prinzessin, oder du mußt sterben!‹ Droßelmeier fing an bitterlich zu weinen, aber Prinzeßchen Pirlipat knackte vergnügt Nüsse. Zum erstenmal fiel dem Arkanisten Pirlipats ungewöhnlicher Appetit nach Nüssen, und der Umstand auf, daß sie mit Zähnchen zur Welt gekommen. In der Tat hatte sie gleich nach der Verwandlung so lange geschrieen, bis ihr zufällig eine Nuß vorkam, die sie sogleich aufknackte, den Kern aß, und dann ruhig wurde. Seit der Zeit fanden die Wärterinnen nichts geraten, als ihr Nüsse zu bringen. ›O heiliger Instinkt der Natur, ewig unerforschliche Sympathie aller Wesen‹, rief Johann Elias Droßelmeier aus: ›du zeigst mir die Pforte zum Geheimnis, ich will anklopfen, und sie wird sich öffnen!‹ Er bat sogleich um die Erlaubnis, mit dem Hofastronom sprechen zu können, und wurde mit starker Wache hingeführt. Beide Herren umarmten sich unter vielen Tränen, da sie zärtliche Freunde waren, zogen sich dann in ein geheimes Kabinett zurück, und schlugen viele Bücher nach, die von dem Instinkt, von den Sympathien und Antipathien und andern geheimnisvollen Dingen handelten. Die Nacht brach herein, der Hofastronom sah nach den Sternen, und stellte mit Hülfe des auch hierin sehr geschickten Droßelmeiers das Horoskop der Prinzessin Pirlipat. Das war eine große Mühe, denn die Linien verwirrten sich immer mehr und mehr, endlich aber – welche Freude, endlich lag es klar vor ihnen, daß die Prinzessin Pirlipat, um den Zauber, der sie verhäßlicht, zu lösen, und um wieder so schön zu werden, als vorher, nichts zu tun hätte, als den süßen Kern der Nuß Krakatuk zu genießen. Die Nuß Krakatuk hatte eine solche harte Schale, daß eine achtundvierzigpfündige Kanone darüber wegfahren konnte, ohne sie zu zerbrechen. Diese harte Nuß mußte aber von einem Manne, der noch nie rasiert worden und der niemals Stiefeln getragen, vor der Prinzessin aufgerissen und ihr von ihm mit geschlossenen Augen der Kern dargereicht werden. Erst nachdem er sieben Schritte rückwärts gegangen, ohne zu stolpern, durfte der junge Mann wieder die Augen erschließen. Drei Tage und drei Nächte hatte Droßelmeier mit dem Astronomen ununterbrochen gearbeitet und es saß gerade des Sonnabends der König bei dem Mittagstisch, als Droßelmeier, der Sonntag in aller Frühe geköpft werden sollte, voller Freude und Jubel hineinstürzte, und das gefundene Mittel, der Prinzessin Pirlipat die verlorene Schönheit wiederzugeben, verkündete. Der König umarmte ihn mit heftigem Wohlwollen, versprach ihm einen diamantenen Degen, vier Orden und zwei neue Sonntagsröcke. ›Gleich nach Tische‹, setzte er freundlich hinzu, ›soll es ans Werk gehen, sorgen Sie, teurer Arkanist, daß der junge unrasierte Mann in Schuhen mit der Nuß Krakatuk gehörig bei der Hand sei, und lassen Sie ihn vorher keinen Wein trinken, damit er nicht stolpert, wenn er sieben Schritte rückwärts geht wie ein Krebs, nachher kann er erklecklich saufen!‹ Droßelmeier wurde über diese Rede des Königs sehr bestürzt, und nicht ohne Zittern und Zagen brachte er es stammelnd heraus, daß das Mittel zwar gefunden wäre, beides, die Nuß Krakatuk und der junge Mann zum Aufbeißen derselben aber erst gesucht werden müßten, wobei es noch obenein zweifelhaft bliebe, ob Nuß und Nußknacker jemals gefunden werden dürften. Hocherzürnt schwang der König den Szepter über das gekrönte Haupt, und schrie mit einer Löwenstimme: ›So bleibt es bei dem Köpfen.‹ Ein Glück war es für den in Angst und Not versetzten Droßelmeier, daß dem Könige das Essen gerade den Tag sehr wohl geschmeckt hatte, er mithin in der guten Laune war, vernünftigen Vorstellungen Gehör zu geben, an denen es die großmütige und von Droßelmeiers Schicksal gerührte Königin nicht mangeln ließ. Droßelmeier faßte Mut und stellte zuletzt vor, daß er doch eigentlich die Aufgabe, das Mittel, wodurch die Prinzessin geheilt werden könne, zu nennen, gelöst, und sein Leben gewonnen habe. Der König nannte das dumme Ausreden und einfältigen Schnickschnack, beschloß aber endlich, nachdem er ein Gläschen Magenwasser zu sich genommen, daß beide, der Uhrmacher und der Astronom, sich auf die Beine machen und nicht anders als mit der Nuß Krakatuk in der Tasche wiederkehren sollten. Der Mann zum Aufbeißen derselben sollte, wie es die Königin vermittelte, durch mehrmaliges Einrücken einer Aufforderung in einheimische und auswärtige Zeitungen und Intelligenz-Blätter herbeigeschafft werden.“ – Der Obergerichtsrat brach hier wieder ab, und versprach den andern Abend das übrige zu erzählen.
|
Die Struktur der dargestellten Welt Die Basiserzählung bildet zunächst die zur Entstehungszeit typische reale bürgerliche Welt ab. Die Handlung setzt am Weihnachtsabend in der Wohnung des Medizinalrats Stahlbaum an und verpflichtet man sich der rationalen Sicht dieser Welt und seiner Vertreter, insbesondere der von Maries Eltern, wird die konkrete räumliche Grenze dieser Welt gar nicht passiert. Die Frage, ob das Fantastische in diese Welt eindringt, so wie es Marie um Mitternacht in der Form der Schlacht zwischen dem Mausekönig mit seinem Mauseheer und dem belebten Nußknacker und seinem Heer aus belebten Puppen, bleiernen Soldaten und Thorn und Dragantfiguren erlebt, bleibt offen. Sie kann und soll keinesfalls exakt beantwortet werden, denn einerseits gehört die daraus resultierende Ambivalenz zum Grundzug Hoffmannschen Erzählens, andererseits regt sie auf extratextueller Ebene den Rezipienten zur aktiven Rezeption und Relektüre an. Eine mögliche Erklärung für den Einbruch des Fantastischen bietet die Metaerzählung, also Das Märchen von der harten Nuß. Auf zweiter Fiktionsebene wird nämlich der angegebenen Gattung des Märchens entsprechend die fiktive Geschichte des Zwistes zwischen dem König und Frau Mauserink, der Königin von Mausolien, und dessen Folgen, also die Verwünschung und Erlösung von Prinzessin Pirlipat und die Entstellung des jungen Droßelmeier zum Nußknacker erzählt. Die Metadiegese erfüllt somit sowohl explikative als auch persuasive Funktion, indem sie einerseits über Nußknackers Identität aufklärt, andererseits Marie dazu anregt, sich mit seiner möglichen Erlöserin zu identifizieren. Im
Prinzip werden hier nur zwei Welten entworfen, die einander aber mehrfach
durchzudringen scheinen. Ihre Erscheinung ist von unterschiedlichem
Glaubwürdigkeitsgrad, oder anders formuliert: ihr ontologischer Status wird
in unterschiedlichem Maße hinterfragt. Am glaubwürdigsten und
vertraulichsten erscheint die bürgerliche Welt der Basiserzählung. Der
Einbruch des Fantastischen in diese Welt wird von Marie anerkannt, während
andere Figuren diese Möglichkeit bestreiten. Die dargestellte Welt der
Metaerzählung behauptet zwar nicht ontologisch existent zu sein, kollidiert
aber mindestens in zwei Punkten mit der real anerkannten bürgerlichen Welt.
Erstens durch die Figuren, die Droßelmeier heißen. Der Arkanist und
Hofuhrmacher heißt ebenso wie der Erzähler des Binnenmärchens, Christian
Elias Droßelmeier, der zugleich eine wichtige Figur der Basiserzählung ist.
Sein Vetter aus Nürnberg, Christian Zacharias Droßelmeier und dessen Sohn,
des Paten Neffe. Im Märchen erlöst der junge Droßelmeier Pirlipat von ihrer
Hässlichkeit, wird selber aber mit dem gleichen Fluch belegt, und verwandelt
sich in einen Nußknacker. Nachdem Einen
zweiten Bereich des Fantastischen bildet das Puppenreich, das Marie mit dem
Nußknacker nach dessen Sieg über den Mausekönig besucht. Während bei den
früheren fantastischen Ereignissen immer wieder Indizien auf die Anwesenheit
der Mäuse zurückblieben, die Maries Perspektive mehr oder weniger
Glaubwürdigkeit gaben, findet sich Marie nach diesem Besuch in ihrem Bett
wieder. Das Puppenreich selber ist weiterhin dermaßen Konditorwaren und
Süßigkeiten nachgebildet, dass man an seine Existenz trotz der Erklärung des
Erzählers nicht glauben kann, wonach die Schwestern von Nußknacker Marie,
die bei ihnen eingeschlafen, unversehens nach Hause und in ihr Bett
zurückgetragen hätten.
Geheime Legationsräte: Der Geheime Rat,
zeitgenössisch und lokal unterschiedlich auch Geheimder Rath oder Geheimbter
Rath, später verkürzt zu Geheimderat oder Geheimrat, war in den
Territorialstaaten des Heiligen Römischen Reichs ein Beraterkollegium, das
den jeweiligen Landesfürsten in der Ausübung seiner Herrschaft unterstützte.
Das Geheime Ratskollegium entsprach einer Regierung, wobei aber die
Regierungsbehörden im Absolutismus allein den Landesherren unterstanden und
oft noch nicht in eigene Zuständigkeitsbereiche (Portefeuilles) mit
verantwortlichen Ministern und entsprechenden Beamtenstäben aufgeteilt
waren; dies erfolgte erst durch die allmähliche Einführung von Ministerien. Krauen: jemanden mit den Fingerkuppen kratzend streicheln
Picken des Holzwurms: Der Gemeine oder
Gewöhnliche Nagekäfer (Anobium punctatum), umgangssprachlich wegen der
Aktivität der Larven auch Holzwurm genannt, ist eine Art der Nagekäfer (Ptinidae).
Die in der Mythologie dem Klopfgeräusch des Holzwurms zugeordnete Deutung
als böses Omen und Vorzeichen des nahenden Todes stammt nicht vom
Gewöhnlichen, sondern meist vom Gescheckten Nagekäfer.
von dem Instinkt, von den Sympathien und Antipathien
und andern geheimnisvollen Dingen: Antipathie (altgriechisch
αντιπάθεια antipatheia, deutsch ‚Gegengefühl, Abneigung‘) ist eine Form der
spontanen Abneigung, die sich primär dann entwickelt, wenn ein Mensch andere
Personen oder Sachen und Gegenstände nicht leiden kann oder nicht mag.
Starke Antipathie kann auch als Hass empfunden werden. Das Gefühl von
Antipathie ist oft mit einer negativen Wertung gegenüber dem Objekt der
Antipathie verbunden. Horoskop: Horoskop, astrologischer Begriff (Stundenseher), Voraussage über kommende Ereignisse aufgrund der Konstellationen von Sonne, Mond und Planeten zum Zeitpunkt der Geburt.
ein Gläschen Magenwasser: ein mit
magenstärkenden Mitteln abgezogener Branntwein; der Magen-Aquavit.
Isa Schikorsky: Im Labyrinth der Phantasie: Ernst Theodor Amadeus Hoffmanns Wirklichkeitsmärchen „Nußknacker und Mausekönig“, S. 526-529. |

|
Beschluß des Märchens von der harten Nuß Am andern Abende, sowie kaum die Lichter angesteckt worden, fand sich Pate Droßelmeier wirklich wieder ein, und erzählte also weiter. „Droßelmeier und der Hofastronom waren schon funfzehn Jahre unterwegs, ohne der Nuß Krakatuk auf die Spur gekommen zu sein. Wo sie überall waren, welche sonderbare seltsame Dinge ihnen widerfuhren, davon könnt ich euch, ihr Kinder, vier Wochen lang erzählen, ich will es aber nicht tun, sondern nur gleich sagen, daß Droßelmeier in seiner tiefen Betrübnis zuletzt eine sehr große Sehnsucht nach seiner lieben Vaterstadt Nürnberg empfand. Ganz besonders überfiel ihn diese Sehnsucht, als er gerade einmal mit seinem Freunde mitten in einem großen Walde in Asien ein Pfeifchen Knaster rauchte. ›O schöne – schöne Vaterstadt Nürnberg – schöne Stadt, wer dich nicht gesehen hat, mag er auch viel gereist sein nach London, Paris und Peterwardein, ist ihm das Herz doch nicht aufgegangen, muß er doch stets nach dir verlangen – nach dir, o Nürnberg, schöne Stadt, die schöne Häuser mit Fenstern hat.‹ – Als Droßelmeier so sehr wehmütig klagte, wurde der Astronom von tiefem Mitleiden ergriffen und fing so jämmerlich zu heulen an, daß man es weit und breit in Asien hören konnte. Doch faßte er sich wieder, wischte sich die Tränen aus den Augen und fragte: ›Aber wertgeschätzter Kollege, warum sitzen wir hier und heulen? warum gehen wir nicht nach Nürnberg, ist's denn nicht gänzlich egal, wo und wie wir die fatale Nuß Krakatuk suchen?‹ ›Das ist auch wahr‹, erwiderte Droßelmeier getröstet. Beide standen alsbald auf, klopften die Pfeifen aus, und gingen schnurgerade in einem Strich fort, aus dem Walde mitten in Asien, nach Nürnberg. Kaum waren sie dort angekommen, so lief Droßelmeier schnell zu seinem Vetter, dem Puppendrechsler, Lackierer und Vergolder Christoph Zacharias Droßelmeier, den er in vielen vielen Jahren nicht mehr gesehen. Dem erzählte nun der Uhrmacher die ganze Geschichte von der Prinzessin Pirlipat, der Frau Mauserinks, und der Nuß Krakatuk, so daß der ein Mal über das andere die Hände zusammenschlug und voll Erstaunen ausrief: ›Ei Vetter, Vetter, was sind das für wunderbare Dinge!‹ Droßelmeier erzählte weiter von den Abenteuern seiner weiten Reise, wie er zwei Jahre bei dem Dattelkönig zugebracht, wie er vom Mandelfürsten schnöde abgewiesen, wie er bei der naturforschenden Gesellschaft in Eichhornshausen vergebens angefragt, kurz wie es ihm überall mißlungen sei, auch nur eine Spur von der Nuß Krakatuk zu erhalten. Während dieser Erzählung hatte Christoph Zacharias oftmals mit den Fingern geschnappt – sich auf einem Fuße herumgedreht – mit der Zunge geschnalzt – dann gerufen – ›Hm hm – I – Ei – O – das wäre der Teufel!‹ – Endlich warf er Mütze und Perücke in die Höhe, umhalste den Vetter mit Heftigkeit und rief: ›Vetter – Vetter! Ihr seid geborgen, geborgen seid Ihr, sag ich, denn alles müßte mich trügen, oder ich besitze selbst die Nuß Krakatuk.‹ Er holte alsbald eine Schachtel hervor, aus der er eine vergoldete Nuß von mittelmäßiger Größe hervorzog. ›Seht‹, sprach er, indem er die Nuß dem Vetter zeigte, ›seht, mit dieser Nuß hat es folgende Bewandtnis: Vor vielen Jahren kam einst zur Weihnachtszeit ein fremder Mann mit einem Sack voll Nüssen hieher, die er feilbot. Gerade vor meiner Puppenbude geriet er in Streit, und setzte den Sack ab, um sich besser gegen den hiesigen Nußverkäufer, der nicht leiden wollte, daß der Fremde Nüsse verkaufe, und ihn deshalb angriff, zu wehren. In dem Augenblick fuhr ein schwer beladener Lastwagen über den Sack, alle Nüsse wurden zerbrochen bis auf eine, die mir der fremde Mann, seltsam lächelnd, für einen blanken Zwanziger vom Jahre 1720 feilbot. Mir schien das wunderbar, ich fand gerade einen solchen Zwanziger in meiner Tasche, wie ihn der Mann haben wollte, kaufte die Nuß und vergoldete sie, selbst nicht recht wissend, warum ich die Nuß so teuer bezahlte und dann so werthielt.‹ Jeder Zweifel, daß des Vetters Nuß wirklich die gesuchte Nuß Krakatuk war, wurde augenblicklich gehoben, als der herbeigerufene Hofastronom das Gold sauber abschabte, und in der Rinde der Nuß das Wort Krakatuk mit chinesischen Charakteren eingegraben fand. Die Freude der Reisenden war groß, und der Vetter der glücklichste Mensch unter der Sonne, als Droßelmeier ihm versicherte, daß sein Glück gemacht sei, da er außer einer ansehnlichen Pension hinfüro alles Gold zum Vergolden umsonst erhalten werde. Beide, der Arkanist und der Astronom, hatten schon die Schlafmützen aufgesetzt und wollten zu Bette gehen, als letzterer, nämlich der Astronom, also anhob: ›Bester Herr Kollege, ein Glück kommt nie allein – Glauben Sie, nicht nur die Nuß Krakatuk, sondern auch den jungen Mann, der sie aufbeißt und den Schönheitskern der Prinzessin darreicht, haben wir gefunden! – Ich meine niemanden anders, als den Sohn Ihres Herrn Vetters! – Nein, nicht schlafen will ich‹, fuhr er begeistert fort, ›sondern noch in dieser Nacht des Jünglings Horoskop stellen!‹ – Damit riß er die Nachtmütze vorn Kopf und fing gleich an zu observieren. – Des Vetters Sohn war in der Tat ein netter wohlgewachsener Junge, der noch nie rasiert worden und niemals Stiefel getragen. In früher Jugend war er zwar ein paar Weihnachten hindurch ein Hampelmann gewesen, das merkte man ihm aber nicht im mindesten an, so war er durch des Vaters Bemühungen ausgebildet worden. An den Weihnachtstagen trug er einen schönen roten Rock mit Gold, einen Degen, den Hut unter dem Arm und eine vorzügliche Frisur mit einem Haarbeutel. So stand er sehr glänzend in seines Vaters Bude und knackte aus angeborner Galanterie den jungen Mädchen die Nüsse auf, weshalb sie ihn auch schön Nußknackerchen nannten. – Den andern Morgen fiel der Astronom dem Arkanisten entzückt um den Hals und rief: ›Er ist es, wir haben ihn, er ist gefunden; nur zwei Dinge, liebster Kollege, dürfen wir nicht außer acht lassen. Fürs erste müssen Sie Ihrem vortrefflichen Neffen einen robusten hölzernen Zopf flechten, der mit dem untern Kinnbacken so in Verbindung steht, daß dieser dadurch stark angezogen werden kann; dann müssen wir aber, kommen wir nach der Residenz, auch sorgfältig verschweigen, daß wir den jungen Mann, der die Nuß Krakatuk aufbeißt, gleich mitgebracht haben; er muß sich vielmehr lange nach uns einfinden. Ich lese in dem Horoskop, daß der König, zerreißen sich erst einige die Zähne ohne weitern Erfolg, dem, der die Nuß aufbeißt und der Prinzessin die verlorene Schönheit wiedergibt, Prinzessin und Nachfolge im Reich zum Lohn versprechen wird.‹ Der Vetter Puppendrechsler war gar höchlich damit zufrieden, daß sein Söhnchen die Prinzessin Pirlipat heiraten und Prinz und König werden sollte, und überließ ihn daher den Gesandten gänzlich. Der Zopf, den Droßelmeier dem jungen hoffnungsvollen Neffen ansetzte, geriet überaus wohl, so daß er mit dem Aufbeißen der härtesten Pfirsichkerne die glänzendsten Versuche anstellte. Da Droßelmeier und der Astronom das Auffinden der Nuß Krakatuk sogleich nach der Residenz berichtet, so waren dort auch auf der Stelle die nötigen Aufforderungen erlassen worden, und als die Reisenden mit dem Schönheitsmittel ankamen, hatten sich schon viele hübsche Leute, unter denen es sogar Prinzen gab, eingefunden, die ihrem gesunden Gebiß vertrauend, die Entzauberung der Prinzessin versuchen wollten. Die Gesandten erschraken nicht wenig, als sie die Prinzessin wiedersahen. Der kleine Körper mit den winzigen Händchen und Füßchen konnte kaum den unförmlichen Kopf tragen. Die Häßlichkeit des Gesichts wurde noch durch einen weißen baumwollenen Bart vermehrt, der sich um Mund und Kinn gelegt hatte. Es kam alles so, wie es der Hofastronom im Horoskop gelesen. Ein Milchbart in Schuhen nach dem andern biß sich an der Nuß Krakatuk Zähne und Kinnbacken wund, ohne der Prinzessin im mindesten zu helfen, und wenn er dann von den dazu bestellten Zahnärzten halb ohnmächtig weggetragen wurde, seufzte er: ›Das war eine harte Nuß!‹ – Als nun der König in der Angst seines Herzens dem, der die Entzauberung vollenden werde, Tochter und Reich versprochen, meldete sich der artige sanfte Jüngling Droßelmeier und bat auch den Versuch beginnen zu dürfen. Keiner als der junge Droßelmeier hatte so sehr der Prinzessin Pirlipat gefallen; sie legte die kleinen Händchen auf das Herz, und seufzte recht innig: ›Ach wenn es doch der wäre, der die Nuß Krakatuk wirklich aufbeißt und mein Mann wird.‹ Nachdem der junge Droßelmeier den König und die Königin, dann aber die Prinzessin Pirlipat, sehr höflich gegrüßt, empfing er aus den Händen des Oberzeremonienmeisters die Nuß Krakatuk, nahm sie ohne weiteres zwischen die Zähne, zog stark den Zopf an, und Krak – Krak zerbröckelte die Schale in viele Stücke. Geschickt reinigte er den Kern von den noch daranhängenden Fasern und überreichte ihn mit einem untertänigen Kratzfuß der Prinzessin, worauf er die Augen verschloß und rückwärts zu schreiten begann. Die Prinzessin verschluckte alsbald den Kern und o Wunder! – verschwunden war die Mißgestalt, und statt ihrer stand ein engelschönes Frauenbild da, das Gesicht wie von lilienweißen und rosaroten Seidenflocken gewebt, die Augen wie glänzende Azure, die vollen Locken wie von Goldfaden gekräuselt. Trompeten und Pauken mischten sich in den lauten Jubel des Volks. Der König, sein ganzer Hof, tanzte wie bei Pirlipats Geburt auf einem Beine, und die Königin mußte mit Eau de Cologne bedient werden, weil sie in Ohnmacht gefallen vor Freude und Entzücken. Der große Tumult brachte den jungen Droßelmeier, der noch seine sieben Schritte zu vollenden hatte, nicht wenig aus der Fassung, doch hielt er sich und streckte eben den rechten Fuß aus zum siebenten Schritt, da erhob sich, häßlich piepend und quiekend, Frau Mauserinks aus dem Fußboden, so daß Droßelmeier, als er den Fuß niedersetzen wollte, auf sie trat und dermaßen stolperte, daß er beinahe gefallen wäre. – O Mißgeschick! – urplötzlich war der Jüngling ebenso mißgestaltet, als es vorher Prinzessin Pirlipat gewesen. Der Körper war zusammengeschrumpft und konnte kaum den dicken ungestalteten Kopf mit großen hervorstechenden Augen und dem breiten entsetzlich aufgähnenden Maule tragen. Statt des Zopfes hing ihm hinten ein schmaler hölzerner Mantel herab, mit dem er den untern Kinnbacken regierte. – Uhrmacher und Astronom waren außer sich vor Schreck und Entsetzen, sie sahen aber wie Frau Mauserinks sich blutend auf dem Boden wälzte. Ihre Bosheit war nicht ungerächt geblieben, denn der junge Droßelmeier hatte sie mit dem spitzen Absatz seines Schuhes so derb in den Hals getroffen, daß sie sterben mußte. Aber indem Frau Mauserinks von der Todesnot erfaßt wurde, da piepte und quiekte sie ganz erbärmlich: O Krakatuk, harte Nuß – an der ich nun sterben muß – hi hi – pipi fein Nußknackerlein wirst auch bald des Todes sein – Söhnlein mit den sieben Kronen, wird's dem Nußknacker lohnen, wird die Mutter rächen fein, an dir du klein Nußknackerlein – o Leben so frisch und rot, von dir scheid ich, o Todesnot! – Quiek –‹ Mit diesem Schrei starb Frau Mauserinks und wurde von dem königlichen Ofenheizer fortgebracht. – Um den jungen Droßelmeier hatte sich niemand bekümmert, die Prinzessin erinnerte aber den König an sein Versprechen, und sogleich befahl er, daß man den jungen Helden herbeischaffe. Als nun aber der Unglückliche in seiner Mißgestalt hervortrat, da hielt die Prinzessin beide Hände vors Gesicht und schrie: ›Fort, fort mit dem abscheulichen Nußknacker!‹ Alsbald ergriff ihn auch der Hofmarschall bei den kleinen Schultern und warf ihn zur Türe heraus. Der König war voller Wut, daß man ihm habe einen Nußknacker als Eidam aufdringen wollen, schob alles auf das Ungeschick des Uhrmachers und des Astronomen, und verwies beide auf ewige Zeiten aus der Residenz. Das hatte nun nicht in dem Horoskop gestanden, welches der Astronom in Nürnberg gestellt, er ließ sich aber nicht abhalten, aufs neue zu observieren und da wollte er in den Sternen lesen, daß der junge Droßelmeier sich in seinem neuen Stande so gut nehmen werde daß er trotz seiner Ungestalt Prinz und König werden würde. Seine Mißgestalt könne aber nur dann verschwinden, wenn der Sohn der Frau Mauserinks, den sie nach dem Tode ihrer sieben Söhne, mit sieben Köpfen geboren, und welcher Mausekönig geworden, von seiner Hand gefallen seie, und eine Dame ihn, trotz seiner Mißgestalt, liebgewinnen werde. Man soll denn auch wirklich den jungen Droßelmeier in Nürnberg zur Weihnachtszeit in seines Vaters Bude, zwar als Nußknacker, aber doch als Prinzen gesehen haben! – Das ist, ihr Kinder! das Märchen von der harten Nuß, und ihr wißt nun warum die Leute so oft sagen: ›Das war eine harte Nuß!‹ und wie es kommt, daß die Nußknacker so häßlich sind.“ So schloß der Obergerichtsrat seine Erzählung. Marie meinte, daß die Prinzessin Pirlipat doch eigentlich ein garstiges undankbares Ding sei; Fritz versicherte dagegen, daß, wenn Nußknacker nur sonst ein braver Kerl sein wolle, er mit dem Mausekönig nicht viel Federlesens machen, und seine vorige hübsche Gestalt bald wiedererlangen werde.
|
Vergegenwärtigt man sich den Aufbau des Märchens, so fällt auf, daß in seinem Zentrum das »Märchen von der harten Nuß« steht, das der Pate Droßelmeier erzählt. Es wird von fast gleich langen Erzählpartien eingerahmt. Dieses Märchen im Märchen ist mit dem vorangegangenen und dem nachfolgenden Geschehen im Text so verbunden, daß es eine Art von Begründung für die Erlebnisse liefert, die Marie im ersten Teil (am Weihnachtsabend) hat, und daß es die Erfahrungen vorbereitet, die Marie im Anschluß an die Märchenerzählung noch bevorstehen. Eine Begründung für Maries Erfahrungen am Weihnachtsabend liefert das Märchen des Paten Droßelmeier insofern, als es dem Kind – sich ganz auf seine Erlebniswelt einstellend und die Figuren dieser Welt aufnehmend – sozusagen rational begreiflich macht, wie es zur Schlacht zwischen dem Mausekönig und dem Nußknacker kommen konnte, die Marie am Weihnachtsabend entsetzt erlebt hatte. Der Pate erfindet eine Vorgeschichte des Nußknackers, in der er in seiner Mißgestalt dasErgebnis der Verwünschung durch ein böses Prinzip (Mäuse) ist, das weiterwirkt. Die Schlacht, die die Mäuse gegen den Nußknacker führen, ist Ausdruck der Zwietracht, die in Vorzeiten zurückreicht. An dieser Zwietracht leidet der Nußknacker sichtlich in seiner disharmonischen Gestalt; er erscheint also als eine Art verwunschener Prinz, den der Pate Droßelmeier, sich selbst und seinen jungen Neffen in das Märchen einbringend, als seinen verwunschenen Neffen benennt und als erlösungsbedürftig darstellt. Der Sieg über das böse Prinzip, den Mausekönig, und die Liebe einer Dame können – dem Märchen des Paten Droßelmeier zufolge – die Harmonie wiederherstellen, und dieser Wiederherstellung gilt im Anschluß an die Märchenerzählung Maries ganze Phantasie. Sie stellt nach der Erfahrung der Disharmonie (erster Teil, Schlacht) und im Wissen um deren Voraussetzung (Märchen des Paten) im dritten Erzählteil kraft ihrer kindlichen Phantasie das Paradies wieder her, wenn sie, »in einem schönen blanken Reich« regierend dem siegreichen Nußknacker eine harmonischparadiesische Welt aus Konfekt durchwandert und den durch ihre eingestandene Liebe erlösten Neffen schließlich zum Mann nehmen wird. Damit wird freilich ein Märchenschluß ins Leben überführt, dem mit Vernunftgründen nicht beizukommen ist. Dieser Erzählaufbau macht deutlich, daß Hoffmann zum Abschluß des ersten Bandes der Serapions-Brüder den Leser mit einer Welt konfrontiert, in der – wie in der des Serapion – noch das Einssein des Menschen mit sich und der Welt, der paradiesische Zustand, erreicht werden kann: in der Phantasiewelt der Kinder. Sie bedürfen freilich des Paten Droßelmeier, des Erzählers, um vor der Disharmonie, tue sie – aus welchen bewußten oder halbbewußten Erlebnissen von Feindschaft und Krieg auch immer – erfahren, nicht in Angst und Entsetzen gebannt zu bleiben, sondern Lim die Kraft der Phantasie zur Erlösung dieser disharmonischen Welt aktivieren zu können. Eine
solche Erzählung zur Aktivierung der Phantasie will der Text sicherlich auch
für Erwachsene sein. Nicht nur, weil er, wie es Lothar ankündigte, die
»trübe Stimmung« nach der Bergwerks-Erzählung durch die »Anmut der
Erfindung« vertreiben will, sondern auch, weil er vom »Fantastischen ins
gewöhnliche Leben« in mehr als einem Sinn >hineinspielt<.
ein Pfeifchen Knaster: Das Wort bezeichnete zur
Zeit der Erstbezeugungen am Anfang des 17. Jahrhunderts einen würzigen,
milden Tabak von hoher Qualität, der in Rohrkörben (Spanisch canastros, zu
Griechisch kánastron) transportiert wurde. Man sprach von Canastertobac, was
zu Canaster/Kanaster und dann durch Vokalausfall zu Knaster verkürzt wurde
und vermutlich in dieser Form über das Niederländische in die deutsche
Sprache entlehnt wurde. Das Wort Knaster erhielt danach erst in der
Studentensprache einen abwertenden Beiklang, der sich verallgemeinert hat. Peterwardein:
Petrovaradin (serbisch-kyrillisch Петроварадин; deutsch: Peterwardein) oder
auch Festung von Novi Sad ist ein Ortsteil von Novi Sad in Serbien und durch
die Varadin-Brücke mit ihr verbunden. Die Schlacht von Peterwardein war eine
Schlacht, die am 5. August 1716 während des 6. Österreichischen
Türkenkrieges zwischen der kaiserlichen Armee und dem osmanischen Heer bei
Peterwardein stattfand. blanken Zwanziger vom Jahre 1720: Goldmünze im Wert von 1/4 Dukat mit chinesischen Charakteren: chinesische Schriftzeichen observieren: Personen über einen längeren Zeitraum beobachten Puppendrechsler: Hersteller von Holzspielzeug und -puppen
glänzende Azure: Azur ist ein Name des Azurits wie
auch für die blauen Schmucksteine: Lapislazuli, Lasurit.
Eau de Cologne: Ursprünglich aus dem 18.
Jahrhundert ist das Eau de Cologne der Firma Johann Maria Farina gegenüber
dem Jülichs-Platz. Der italienische Parfümeur Johann Maria Farina
(1685–1766) schuf 1709 aus Ölen von Zitrone, Orange, Bergamotte, Mandarine,
Limette, Zeder und Pampelmuse sowie Kräutern ein Duftwasser, das er zu Ehren
seiner Wahlheimatstadt Eau de Cologne zum ersten Mal in einem Brief
von 1742 so benannte. Das Haus „Farina gegenüber“ übernahm damit die
Herkunftsbezeichnung, die französische Offiziere dem Eau Admirable
beigegeben hatten, und wurde so zum Erfinder des „Kölnisch Wasser“, das noch
heute von der Firma in unveränderter Rezeptur hergestellt wird.
Isa Schikorsky: Im Labyrinth der Phantasie: Ernst Theodor Amadeus Hoffmanns Wirklichkeitsmärchen „Nußknacker und Mausekönig“, S. 529-535. |

|
Onkel und Neffe Hat jemand von meinen hochverehrtesten Lesern oder Zuhörern jemals den Zufall erlebt, sich mit Glas zu schneiden, so wird er selbst wissen, wie wehe es tut, und welch schlimmes Ding es überhaupt ist, da es so langsam heilt. Hatte doch Marie beinahe eine ganze Woche im Bett zubringen müssen, weil es ihr immer ganz schwindlicht zumute wurde, sobald sie aufstand. Endlich aber wurde sie ganz gesund, und konnte lustig, wie sonst, in der Stube umherspringen. Im Glasschrank sah es ganz hübsch aus, denn neu und blank standen da, Bäume und Blumen und Häuser, und schöne glänzende Puppen. Vor allen Dingen fand Marie ihren lieben Nußknacker wieder, der, in dem zweiten Fache stehend, mit ganz gesunden Zähnchen sie anlächelte. Als sie nun den Liebling so recht mit Herzenslust anblickte, da fiel es ihr mit einemmal sehr bänglich aufs Herz, daß alles, was Pate Droßelmeier erzählt habe, ja nur die Geschichte des Nußknackers und seines Zwistes mit der Frau Mauserinks und ihrem Sohne gewesen. Nun wußte sie, daß ihr Nußknacker kein anderer sein könne, als der junge Droßelmeier aus Nürnberg, des Pate Droßelmeiers angenehmer, aber leider von der Frau Mauserinks verhexten Neffe. Denn daß der künstliche Uhrmacher am Hofe von Pirlipats Vater niemand anders gewesen, als der Obergerichtsrat Droßelmeier selbst, daran hatte Marie schon bei der Erzählung nicht einen Augenblick gezweifelt. „Aber warum half dir der Onkel denn nicht, warum half er dir nicht“, so klagte Marie, als sich es immer lebendiger und lebendiger in ihr gestaltete, daß es in jener Schlacht, die sie mit ansah, Nußknackers Reich und Krone galt. Waren denn nicht alle übrigen Puppen ihm untertan, und war es denn nicht gewiß, daß die Prophezeiung des Hofastronomen eingetroffen, und der junge Droßelmeier König des Puppenreichs geworden? Indem die kluge Marie das alles so recht im Sinn erwägte, glaubte sie auch, daß Nußknacker und seine Vasallen in dem Augenblick, daß sie ihnen Leben und Bewegung zutraute, auch wirklich leben und sich bewegen müßten. Dem war aber nicht so, alles im Schranke blieb vielmehr starr und regungslos, und Marie weit entfernt, ihre innere Überzeugung aufzugeben, schob das nur auf die fortwirkende Verhexung der Frau Mauserinks und ihres siebenköpfigen Sohnes. „Doch“, sprach sie laut zum Nußknacker: „wenn Sie auch nicht imstande sind, sich zu bewegen, oder ein Wörtchen mit mir zu sprechen, lieber Herr Droßelmeier! so weiß ich doch, daß Sie mich verstehen, und es wissen, wie gut ich es mit Ihnen meine; rechnen Sie auf meinen Beistand, wenn Sie dessen bedürfen. – Wenigstens will ich den Onkel bitten, daß er Ihnen mit seiner Geschicklichkeit beispringe, wo es nötig ist.“ Nußknacker blieb still und ruhig, aber Marien war es so, als atme ein leiser Seufzer durch den Glasschrank, wovon die Glasscheiben kaum hörbar, aber wunderlieblich ertönten, und es war, als sänge ein kleines Glockenstimmchen: „Maria klein – Schutzenglein mein – Dein werd ich sein – Maria mein.“ Marie fühlte in den eiskalten Schauern, die sie überliefen, doch ein seltsames Wohlbehagen. Die Dämmerung war eingebrochen, der Medizinalrat trat mit dem Paten Droßelmeier hinein, und nicht lange dauerte es, so hatte Luise den Teetisch geordnet, und die Familie saß ringsumher, allerlei Lustiges miteinander sprechend. Marie hatte ganz still ihr kleines Lehnstühlchen herbeigeholt, und sich zu den Füßen des Paten Droßelmeier gesetzt. Als nun gerade einmal alle schwiegen, da sah Marie mit ihren großen blauen Augen dem Obergerichtsrat starr ins Gesicht und sprach: „Ich weiß jetzt, lieber Pate Droßelmeier, daß mein Nußknacker dein Neffe, der junge Droßelmeier aus Nürnberg ist; Prinz, oder vielmehr König ist er geworden, das ist richtig eingetroffen, wie es dein Begleiter, der Astronom, vorausgesagt hat; aber du weißt es ja, daß er mit dem Sohne der Frau Mauserinks, mit dem häßlichen Mausekönig, in offnem Kriege steht. Warum hilfst du ihm nicht?“ Marie erzählte nun nochmals den ganzen Verlauf der Schlacht, wie sie es angesehen, und wurde oft durch das laute Gelächter der Mutter und Luisens unterbrochen. Nur Fritz und Droßelmeier blieben ernsthaft. „Aber wo kriegt das Mädchen all das tolle Zeug in den Kopf“, sagte der Medizinalrat. „Ei nun“, erwiderte die Mutter, „hat sie doch eine lebhafte Fantasie – eigentlich sind es nur Träume, die das heftige Wundfieber erzeugte.“ „Es ist alles nicht wahr“, sprach Fritz, „solche Poltrons sind meine roten Husaren nicht, Potz Bassa Manelka, wie würd ich sonst darunterfahren.“ Seltsam lächelnd nahm aber Pate Droßelmeier die kleine Marie auf den Schoß, und sprach sanfter als je: „Ei, dir liebe Marie ist ja mehr gegeben, als mir und uns allen; du bist, wie Pirlipat, eine geborne Prinzessin, denn du regierst in einem schönen blanken Reich. – Aber viel hast du zu leiden, wenn du dich des armen mißgestalteten Nußknackers annehmen willst, da ihn der Mausekönig auf allen Wegen und Stegen verfolgt. – Doch nicht ich – du du allein kannst ihn retten, sei standhaft und treu.“ Weder Marie noch irgend jemand wußte, was Droßelmeier mit diesen Worten sagen wollte, vielmehr kam es dem Medizinalrat so sonderbar vor, daß er dem Obergerichtsrat an den Puls fühlte und sagte: „Sie haben, wertester Freund, starke Kongestionen nach dem Kopfe, ich will Ihnen etwas aufschreiben.“ Nur die Medizinalrätin schüttelte bedächtlich den Kopf, und sprach leise: „Ich ahne wohl, was der Obergerichtsrat meint, doch mit deutlichen Worten sagen kann ich's nicht.“
|
Hoffmann stellt mit Nußknacker
und Mausekönig die Wahrnehmung und Perspektive des Kindes in den
Mittelpunkt, ohne sie als falsch oder naiv zu deklarieren. Das verklärte
Bild der Frühromantiker differenziert Hoffmann insofern, als dass er
kindlichen Phantasie ernst nimmt und zugleich ihre möglichen Gefahren
beleuchtet, wie sie bereits durch Johann Gottfried Herder in seiner Vorrede
zum ersten Band der Palmblätter (1786) angesprochen wurden. Einen Gegenpol
zu Maries überbordender Phantasie bilden die Eltern (und später auch Fritz),
die vom aufklärerischen Prinzip der Vernunft geleitet sind, obwohl die
Mutter einmal zugesteht, dass es Dinge geben könne, die man mit dem Verstand
allein nicht erfassen könne. Der Pate Droßelmeier nimmt eine
Zwischenstellung ein. Er verkörpert sowohl die frühromantische Sehnsucht
nach einer Rückkehr in die eigene Kindheit als auch die spätromantische
Warnung vor den Kehrseiten der Phantasie: "Aber viel hast du zu leiden, wenn
du dich des armen missgestalteten Nußknackers annehmen willst!" (S. 88). Die
Darstellung des Alltags wird nach den Gesetzen des modernen psychologischen
Realismus gestaltet, der eigentlich das Wunderbare ausschließt. Dadurch wird
der Zusammenprall von Realitäts- und Märchenerfahrung mehrdeutig. Die
phantastischen Ereignisse können als Traum, Einbildung, Wirklichkeit oder
Bewusstseinskrise gedeutet werden. Marie wird mit beiden Erfahrungsweisen
konfrontiert und gerät in einen psychischen Konflikt. Von ihr werden die
Ereignisse als Wirklichkeit empfunden, von den Eltern jedoch als
Fieberträume. Der Pate nimmt eine Mittlerfunktion ein, weil er noch am
ehesten Verständnis für Marie zeigt. Der auktoriale Erzähler stellt sich mit
seinen Kommentaren scheinbar auf die Seite Maries, tatsächlich deutet er auf
den ambivalenten Status der Erzählung hin, in der sich kindliche und
erwachsene Perspektive wiederspiegeln. Kinderpsychologie und Pädagogik Hoffmanns Kindermärchen weist etliche Parallelen mit Erkenntnissen der zeitgenössischen Kinderpsychologie und Pädagogik auf. Bereits Karl Philipp Moritz hatte in dem von ihm herausgegebenen Magazin zur Erfahrungsseelenkunde (1783-93) der Lebensphase Kindheit einen besonderen Stellenwert eingeräumt, indem er autobiographische Berichte über Kindheitserlebnisse und Beobachtungsstudien über Kinder abdruckte. In seinen eigenen Beiträgen verwies er auf den Einfluss des Elternhauses auf die frühe kindliche Entwicklung. Dabei betonte er die Bedeutung der kindlichen Phantasietätigkeit, weil diese nicht nur die kindliche Entwicklung fördern, sondern auch der Verarbeitung von familiären Konflikten bis hin zu traumatischen Eindrücken dienen würde. Moritz’ Ideen wurden von Dieterich Tiedemann in Untersuchungen über den Menschen (1778) sowie Jean Paul aufgegriffen, der im dritten Kapitel von Levana oder Erziehlehre (1814) eine Theorie des kindlichen Spiels konzipierte. Tiedemann weist darauf hin, dass Kinder lange nicht - ein genaues Alter nennt Tiedemann nicht - zwischen Phantasie und Wirklichkeit unterscheiden könnten und ihnen deshalb die Distinktion zwischen Imagination, Traum und Realität schwer falle. Verstärkt werde diese Tendenz bei besonders sensiblen, aber auch bei kranken Kindern (342), denen Tiedemann eine hohe poetische Einbildungskraft zuschreibt. Jean Paul wiederum vergleicht das kindliche Spiel mit der schöpferischen Dichtkraft und charakterisiert es deshalb als "erste Poesie des Menschen" (S. 603). Beim Spiel mit Puppen oder mit Gegenständen übernehme das Kind die Rolle eines "Theaterdichter(s) und Regisseur(s)" (S. 604). Des Weiteren führt Jean Paul aus, dass gerade der Umgang mit "toten Spielsachen" deshalb so wichtig sei, weil diese in der kindlichen Vorstellung lebendig und sogar als menschliche Wesen wahrgenommen würden (S. 605). Diese Fähigkeit der Projektion sieht Jean Paul als wichtigen Schritt in der Entwicklung des Kindes an, weil es ihm einen Zugang zur Sphäre der Phantasie und Imagination gewähre. Bereits im frühromantischen Diskurs über Kindheit wurde dem Kind eine besondere Affinität zur Phantasie zugesprochen (Alefeld 1996; Baader 1996; Ewers 1989). Jean Paul sieht diese Befähigung als einen Prozess an, der einem Wandel unterliegt. So ginge das symbolische Spielen mit dem fortschreitenden Alter des Kindes in ein Rollenspiel über, indem das Kind nicht mehr für sich allein spielt, sondern sich anderen Kindern zuwendet. Dadurch wandelt sich auch der Charakter des kindlichen Spiels, wobei die kindliche Phantasiewelt zunehmend durch die Beschäftigung mit der Alltagswirklichkeit in den Hintergrund gedrängt werde. Vergleichbare Ideen zur kindlichen Phantasietätigkeit und zur Bedeutung des kindlichen Spiels finden sich im 20. Jahrhundert bei Jean Piaget und Lawrence Kohlberg, wobei beide Psychologen den Übergang vom symbolischen Spiel zum Rollenspiel und damit einhergehend die Fähigkeit, zwischen Realität und Phantasie zu unterscheiden, auf das 7./8. Lebensjahr festlegen (Schikorsky 1995). Dieser Prozess gehe mit einem auffallenden Verstummen der Kinder einher. Während sie vorher noch freimütig alle Erlebnisse, Phantasien und Träume berichten würden, entwickelten sie nunmehr eine Scheu gegenüber Erwachsenen und würden ihre Geheimnisse eher Gleichaltrigen anvertrauen. Wie man
daraus ersieht, lässt sich eine Verbindungslinie von den theoretischen
Überlegungen Karl Philipp Moritz’, Dieterich Tiedemanns und Jean Pauls sowie
der auf den spätromantischen Kindheitsdiskurs rekurrierenden
Erzählung Nussknacker und Mausekönig von Hoffmann bis hin zur modernen
Kindheitspsychologie ziehen. Hoffmann zeigt folglich ein für seine Zeit
ungewöhnliches Verständnis für psychische Phänomene und besaß die Fähigkeit,
sie in eindringlicher Weise darzustellen (Steinlein 1999). Dieser Blick in
die kindliche Seele war innovativ und wegweisend für spätere
Kinderbuchautoren. Über eine Synthese dieser von einem
entwicklungspsychologischen Ansatz ausgehenden Ideen der genannten Autoren
hinaus stellt Hoffmann des Weiteren den Reifungsprozess eines Kindes in den
Fokus. Dass es Hoffmann gelingt, Spiel- und Phantasiewelt eines Kindes in
Einklang zu bringen, enthüllt sich auch bei der Reise von Marie und
Nussknacker ins Zuckerbäckerland. Hier trifft Marie auf ihre eigenen Puppen
und die Spielzeugsoldaten und -figuren von Fritz, die nunmehr die Bewohner
des vom Nussknacker regierten Puppenreiches sind. Bemerkenswert ist hierbei
die synästhetische Qualität des Puppenreichs, die an Herders Bemerkungen
über die sinnliche Welterfahrung des Kindes erinnert. Bei ihrem Eintritt in
das Königreich des Nussknackers strömen visuelle, auditive, olfaktorische
und haptische Eindrücke auf sie ein. Mausekönig: Im Mittelalter stellte man sich vor, dass Gruppen von Ratten von einer besonders großen Ratte, einem so genannten Rattenkönig, beherrscht würden. Dieser Rattenkönig sollte der Sage nach von den untergebenen Ratten gefüttert und auf einem Thron aus miteinander verbundenen Rattenschwänzen getragen werden. Dass eine solche königliche Ratte nicht existiert, stellte sich mit zunehmendem Wissen über die Lebensweise der Ratten heraus. Die Vorstellung eines Throns aus Rattenschwänzen geht allerdings tatsächlich auf ein seltenes, reales Phänomen zurück, das im Laufe der Zeit die Bezeichnung „Rattenkönig“ erhielt.
Poltrons: Angeber, Aufpudler, Aufschneider, Bramarbas, Großsprecher, Großtuer, Möchtegern Potz Bassa Manelka: Bassa Manelka!: ungar. Fluch (Bassa/Pascha = Herr; Manelka: Schweineart). Kongestionen: Unter Kongestion versteht man die Zunahme der Blutmenge in einem bestimmten Gebiet des Körpers. |

|
Der Sieg Nicht lange dauerte es, als Marie in der mondhellen Nacht durch ein seltsames Poltern geweckt wurde, das aus einer Ecke des Zimmers zu kommen schien. Es war, als würden kleine Steine hin und her geworfen und gerollt, und recht widrig pfiff und quiekte es dazwischen. „Ach die Mäuse, die Mäuse kommen wieder“, rief Marie erschrocken, und wollte die Mutter wecken, aber jeder Laut stockte, ja sie vermochte kein Glied zu regen, als sie sah, wie der Mausekönig sich durch ein Loch der Mauer hervorarbeitete, und endlich mit funkelnden Augen und Kronen im Zimmer herum, dann aber mit einem gewaltigen Satz auf den kleinen Tisch, der dicht neben Mariens Bette stand, heraufsprang. „Hi – hi – hi – mußt mir deine Zuckererbsen – deinen Marzipan geben, klein Ding – sonst zerbeiß ich deinen Nußknacker – deinen Nußknacker!“ – So pfiff Mausekönig, knapperte und knirschte dabei sehr häßlich mit den Zähnen, und sprang dann schnell wieder fort durch das Mauerloch. Marie war so geängstet von der graulichen Erscheinung, daß sie den andern Morgen ganz blaß aussah, und im Innersten aufgeregt, kaum ein Wort zu reden vermochte. Hundertmal wollte sie der Mutter oder der Luise, oder wenigstens dem Fritz klagen, was ihr geschehen, aber sie dachte: „Glaubt's mir denn einer, und werd ich nicht obendrein tüchtig ausgelacht?“ – Das war ihr denn aber wohl klar, daß sie um den Nußknacker zu retten, Zuckererbsen und Marzipan hergeben müsse. So viel sie davon besaß, legte sie daher den andern Abend hin vor der Leiste des Schranks. Am Morgen sagte die Medizinalrätin: „Ich weiß nicht, woher die Mäuse mit einemmal in unser Wohnzimmer kommen, sieh nur, arme Marie! sie haben dir all dein Zuckerwerk aufgefressen.“ Wirklich war es so. Den gefüllten Marzipan hatte der gefräßige Mausekönig nicht nach seinem Geschmack gefunden, aber mit scharfen Zähnen benagt, so daß er weggeworfen werden mußte. Marie machte sich gar nichts mehr aus dem Zuckerwerk, sondern war vielmehr im Innersten erfreut, da sie ihren Nußknacker gerettet glaubte. Doch wie ward ihr, als in der folgenden Nacht es dicht an ihren Ohren pfiff und quiekte. Ach der Mausekönig war wieder da, und noch abscheulicher, wie in der vorvorigen Nacht, funkelten seine Augen, und noch widriger pfiff er zwischen den Zähnen. „Mußt mir deine Zucker-, deine Dragantpuppen geben, klein Ding, sonst zerbeiß ich deinen Nußknacker, deinen Nußknacker“, und damit sprang der greuliche Mausekönig wieder fort – Marie war sehr betrübt, sie ging den andern Morgen an den Schrank, und sah mit den wehmütigsten Blicken ihre Zucker- und Dragantpüppchen an. Aber ihr Schmerz war auch gerecht, denn nicht glauben magst du's, meine aufmerksame Zuhörerin Marie! was für ganz allerliebste Figürchen aus Zucker oder Dragant geformt die kleine Marie Stahlbaum besaß. Nächstdem, daß ein sehr hübscher Schäfer mit seiner Schäferin eine ganze Herde milchweißer Schäflein weidete, und dabei sein muntres Hündchen herumsprang, so traten auch zwei Briefträger mit Briefen in der Hand einher, und vier sehr hübsche Paare, sauber gekleidete Jünglinge mit überaus herrlich geputzten Mädchen schaukelten sich in einer russischen Schaukel. Hinter einigen Tänzern stand noch der Pachter Feldkümmel mit der Jungfrau von Orleans, aus denen sich Marie nicht viel machte, aber ganz im Winkelchen stand ein rotbäckiges Kindlein, Mariens Liebling, die Tränen stürzten der kleinen Marie aus den Augen. „Ach“, rief sie, sich zu dem Nußknacker wendend, „lieber Herr Droßelmeier, was will ich nicht alles tun, um Sie zu retten; aber es ist doch sehr hart!“ – Nußknacker sah indessen so weinerlich aus, daß Marie, da es überdem ihr war, als sähe sie Mausekönigs sieben Rachen geöffnet, den unglücklichen Jüngling zu verschlingen, alles aufzuopfern beschloß. Alle Zuckerpüppchen setzte sie daher abends, wie zuvor das Zuckerwerk, an die Leiste des Schranks. Sie küßte den Schäfer, die Schäferin, die Lämmerchen, und holte auch zuletzt ihren Liebling, das kleine rotbäckige Kindlein von Dragant aus dem Winkel, welches sie jedoch ganz hinterwärts stellte. Pachter Feldkümmel und die Jungfrau von Orleans mußten in die erste Reihe. „Nein das ist zu arg“, rief die Medizinalrätin am andern Morgen. „Es muß durchaus eine große garstige Maus in dem Glasschrank hausen, denn alle schöne Zuckerpüppchen der armen Marie sind zernagt und zerrissen.“ Marie konnte sich zwar der Tränen nicht enthalten, sie lächelte aber doch bald wieder, denn sie dachte: „Was tut's, ist doch Nußknacker gerettet.“ Der Medizinalrat sagte am Abend, als die Mutter dem Obergerichtsrat von dem Unfug erzählte, den eine Maus im Glasschrank der Kinder treibe: „Es ist doch aber abscheulich, daß wir die fatale Maus nicht vertilgen können, die im Glasschrank so ihr Wesen treibt, und der armen Marie alles Zuckerwerk wegfrißt.“ „Ei“, fiel Fritz ganz lustig ein: „der Bäcker unten hat einen ganz vortrefflichen grauen Legationsrat, den will ich heraufholen. Er wird dem Dinge bald ein Ende machen, und der Maus den Kopf abbeißen, ist sie auch die Frau Mauserinks selbst, oder ihr Sohn, der Mausekönig.“ „Und“, fuhr die Medizinalrätin lachend fort, „auf Stühle und Tische herumspringen, und Gläser und Tassen herabwerfen und tausend andern Schaden anrichten.“ „Ach nein doch“, erwiderte Fritz, „Bäckers Legationsrat ist ein geschickter Mann, ich möchte nur so zierlich auf dem spitzen Dach gehen können, wie er.“ „Nur keinen Kater zu Nachtzeit“, bat Luise, die keine Katzen leiden konnte. „Eigentlich“, sprach der Medizinalrat, „eigentlich hat Fritz recht, indessen können wir ja auch eine Falle aufstellen; haben wir denn keine?“ --“Die kann uns Pate Droßelmeier am besten machen, der hat sie ja erfunden“, rief Fritz. Alle lachten, und auf die Versicherung der Medizinalrätin, daß keine Falle im Hause sei, verkündete der Obergerichtsrat, daß er mehrere dergleichen besitze, und ließ wirklich zur Stunde eine ganz vortreffliche Mausfalle von Hause herbeiholen. Dem Fritz und der Marie ging nun des Paten Märchen von der harten Nuß ganz lebendig auf. Als die Köchin den Speck röstete, zitterte und bebte Marie, und sprach ganz erfüllt von dem Märchen und den Wunderdingen darin, zur wohlbekannten Dore: „Ach Frau Königin, hüten Sie sich doch nur vor der Frau Mauserinks und ihrer Familie.“ Fritz hatte aber seinen Säbel gezogen, und sprach: „Ja die sollten nur kommen, denen wollt ich eins auswischen.“ Es blieb aber alles unter und auf dem Herde ruhig. Als nun der Obergerichtsrat den Speck an ein feines Fädchen band, und leise, leise die Falle an den Glasschrank setzte, da rief Fritz: „Nimm dich in acht, Pate Uhrmacher, daß dir Mausekönig keinen Possen spielt.“ – Ach wie ging es der armen Marie in der folgenden Nacht! Eiskalt tupfte es auf ihrem Arm hin und her, und rauh und ekelhaft legte es sich an ihre Wange, und piepte und quiekte ihr ins Ohr. – Der abscheuliche Mauskönig saß auf ihrer Schulter, und blutrot geiferte er aus den sieben geöffneten Rachen, und mit den Zähnen knatternd und knirschend, zischte er der vor Grauen und Schreck erstarrten Marie ins Ohr: „Zisch aus – zisch aus, geh nicht ins Haus – geh nicht zum Schmaus – werd nicht gefangen – zisch aus – gib heraus, gib heraus, deine Bilderbücher all, dein Kleidchen dazu, sonst hast keine Ruh – magst's nur wissen, Nußknackerlein wirst sonst missen, der wird zerrissen – hi hi – pi pi – quiek quiek!“ – Nun war Marie voll Jammer und Betrübnis – sie sah ganz blaß und verstört aus, als die Mutter am andern Morgen sagte: „Die böse Maus hat sich noch nicht gefangen“, so daß die Mutter in dem Glauben, daß Marie um ihr Zuckerwerk traure, und sich überdem vor der Maus fürchte, hinzufügte: „Aber sei nur ruhig, liebes Kind, die böse Maus wollen wir schon vertreiben. Helfen die Fallen nichts, so soll Fritz seinen grauen Legationsrat herbeibringen.“ Kaum befand sich Marie im Wohnzimmer allein, als sie vor den Glasschrank trat, und schluchzend also zum Nußknacker sprach: „Ach mein lieber guter Herr Droßelmeier, was kann ich armes unglückliches Mädchen für Sie tun? – Gäb ich nun auch alle meine Bilderbücher, ja selbst mein schönes neues Kleidchen, das mir der Heilige Christ einbeschert hat, dem abscheulichen Mausekönig zum Zerbeißen her, wird er denn nicht doch noch immer mehr verlangen, so daß ich zuletzt nichts mehr haben werde, und er gar mich selbst statt Ihrer zerreißen wollen wird? – O ich armes Kind, was soll ich denn nun tun – was soll ich denn nun tun?“ – Als die kleine Marie so jammerte und klagte, bemerkte sie, daß dem Nußknacker von jener Nacht her ein großer Blutfleck am Halse sitzengeblieben war. Seit der Zeit, daß Marie wußte, wie ihr Nußknacker eigentlich der junge Droßelmeier, des Obergerichtsrats Neffe sei, trug sie ihn nicht mehr auf dem Arm, und herzte und küßte ihn nicht mehr, ja sie mochte ihn aus einer gewissen Scheu gar nicht einmal viel anrühren; jetzt nahm sie ihn aber sehr behutsam aus dem Fache, und fing an, den Blutfleck am Halse mit ihrem Schnupftuch abzureiben. Aber wie ward ihr, als sie plötzlich fühlte, daß Nußknackerlein in ihrer Hand erwarmte, und sich zu regen begann. Schnell setzte sie ihn wieder ins Fach, da wackelte das Mündchen hin und her, und mühsam lispelte Nußknackerlein: „Ach, werteste Demoiselle Stahlbaum – vortreffliche Freundin, was verdanke ich Ihnen alles – Nein, kein Bilderbuch, kein Christkleidchen sollen Sie für mich opfern – schaffen Sie nur ein Schwert – ein Schwert, für das übrige will ich sorgen, mag er –“ Hier ging dem Nußknacker die Sprache aus, und seine erst zum Ausdruck der innigsten Wehmut beseelten Augen wurden wieder starr und leblos. Marie empfand gar kein Grauen, vielmehr hüpfte sie vor Freuden, da sie nun ein Mittel wußte, den Nußknacker ohne weitere schmerzhafte Aufopferungen zu retten. Aber wo nun ein Schwert für den Kleinen hernehmen? – Marie beschloß, Fritzen zu Rate zu ziehen, und erzählte ihm abends, als sie, da die Eltern ausgegangen, einsam in der Wohnstube am Glasschrank saßen, alles, was ihr mit dem Nußknacker und dem Mausekönig widerfahren, und worauf es nun ankomme, den Nußknacker zu retten. Über nichts wurde Fritz nachdenklicher, als darüber, daß sich, nach Mariens Bericht, seine Husaren in der Schlacht so schlecht genommen haben sollten. Er frug noch einmal sehr ernst, ob es sich wirklich so verhalte, und nachdem es Marie auf ihr Wort versichert, so ging Fritz schnell nach dem Glasschrank, hielt seinen Husaren eine pathetische Rede, und schnitt dann, zur Strafe ihrer Selbstsucht und Feigheit, einem nach dem andern das Feldzeichen von der Mütze, und untersagte ihnen auch, binnen einem Jahr den Gardehusarenmarsch zu blasen. Nachdem er sein Strafamt vollendet, wandte er sich wieder zu Marien, sprechend: „Was den Säbel betrifft, so kann ich dem Nußknacker helfen, da ich einen alten Obristen von den Kürassiers gestern mit Pension in Ruhestand versetzt habe, der folglich seinen schönen scharfen Säbel nicht mehr braucht.“ Besagter Obrister verzehrte die ihm von Fritzen angewiesene Pension in der hintersten Ecke des dritten Faches. Dort wurde er hervorgeholt, ihm der in der Tat schmucke silberne Säbel abgenommen, und dem Nußknacker umgehängt. Vor bangem Grauen konnte Marie in der folgenden Nacht nicht einschlafen, es war ihr um Mitternacht so, als höre sie im Wohnzimmer ein seltsames Rumoren, Klirren und Rauschen. – Mit einemmal ging es: „Quiek!“ – „Der Mausekönig! der Mausekönig!“ rief Marie, und sprang voll Entsetzen aus dem Bette. Alles blieb still; aber bald klopfte es leise, leise an die Türe, und ein feines Stimmchen ließ sich vernehmen: „Allerbeste Demoiselle Stahlbaum, machen Sie nur getrost auf – gute fröhliche Botschaft!“ Marie erkannte die Stimme des jungen Droßelmeier, warf ihr Röckchen über, und öffnete flugs die Türe. Nußknackerlein stand draußen, das blutige Schwert in der rechten, ein Wachslichtchen in der linken Hand. Sowie er Marien erblickte, ließ er sich auf ein Knie nieder, und sprach also: „Ihr, o Dame! seid es allein, die mich mit Rittermut stählte, und meinem Arme Kraft gab, den Übermütigen zu bekämpfen, der es wagte, Euch zu höhnen. Überwunden liegt der verräterische Mausekönig und wälzt sich in seinem Blute! – Wollet, o Dame! die Zeichen des Sieges aus der Hand Eures Euch bis in den Tod ergebenen Ritters anzunehmen nicht verschmähen!“ Damit streifte Nußknackerchen die sieben goldenen Kronen des Mausekönigs, die er auf den linken Arm heraufgestreift hatte, sehr geschickt herunter, und überreichte sie Marien, welche sie voller Freude annahm. Nußknacker stand auf, und fuhr also fort: „Ach meine allerbeste Demoiselle Stahlbaum, was könnte ich in diesem Augenblicke, da ich meinen Feind überwunden, Sie für herrliche Dinge schauen lassen, wenn Sie die Gewogenheit hätten, mir nun ein paar Schrittchen zu folgen! – O tun Sie es – tun Sie es, beste Demoiselle!“ |
Den
finalen Kampf zwischen dem Nußknacker und dem Mausekönig hat Hoffmann als
gezeichnetes und koloriertes Titelbild dem Erstdruck seines Märchens
beigegeben. Es verweist einerseits auf die entscheidende inhaltliche
Situation des Märchens, auf die einander gegenüberstehenden Prinzipien von
Gut und Böse, von Schön und Häßlich und darauf, daß das gute Marzipan-Ende
nur durch Kampf, Schlacht und Tod herbeigeführt werden kann. Andererseits
aber sind die beiden Positionen des Nußknackers und des Mausekönigs, die man
auf dem Titelblatt sieht, auch Erscheinungsformen der zeitgenössischen
Vorstellungen und Bilder, die man sich von keinem Geringeren als von
Napoleon gemacht hat. Titelblatt. Kolorierte Aquatinta-Zeichnung von Hoffmann. Die
Völkerschlacht bei Leipzig, auch als Schlacht von Leipzig bekannt, vom 16.
bis 19. Oktober 1813 war die entscheidende Schlacht der Befreiungskriege.
Dabei besiegten die Truppen der Koalition von Russland, Preußen, Österreich
und Schweden sowie kleineren Fürstentümern die Truppen Frankreichs und
seiner Verbündeten unter Napoleon Bonaparte. Die Folge war Napoleons Rückzug
aus Deutschland, begleitet vom Zusammenbruch des Rheinbunds als Stütze
seiner Herrschaft.
„Die Völkerschlacht von Leipzig im Oktober 1813“: Das 1815 erstellte Gemälde von Wladimir Iwanowitsch Moschkow (1792-1839) befindet sich im Staatlichen Russischen Museum in St. Petersburg.
Dragantpuppen: Tragánt, der aus dem Stamm
zahlreicher Arten von Astragalus ausfließende, an der Luft erhärtende
Gummischleim. Handelssorten: Smyrnaer T., aus Kleinasien, flache (Blätter-T.),
faden- oder wurmförmige Stücke (Faden-T., Vermizell); persischer (syrischer)
T., weiß, knollig oder traubig; Morea-T., bräunliche, unregelmäßige Stücke,
von Kreta und Griechenland. Der T. enthält Bassorin, wird als Bindemittel zu
Pastillen, Pillen, Emulsionen und Konditoreiwaren (Tragantfiguren, -blumen),
zum Appretieren, in der Kattundruckerei etc. verwendet.
Dragant-Figuren in einer russischen Schaukel: Gerät der Parterreakrobatik: Ein langes Brett ist mit 2-3 m langen Stangen an einer Drehachse befestigt. Auf dem Brett befinden sich schaukelnd mehrere Akrobaten, wobei jeweils der vorderste durch den erzeugten Schwung in weitem Flug in die Höhe und nach vorne geworfen wird. Er landet auf einer Matte, in den Händen eines Fängers, auf einem Untermann oder an einem Gerät. Während des Fluges werden Salti, Pirouetten usw. ausgeführt.
Porzellanfiguren Pachter Feldkümmel: Prachter Feldkümmel ist die Titelfigur in August von kotzebues Posse Prachter Feldkümmel von Feldkirchen (1811). Jungfrau von Orleans: Die Jungfrau von Orleans ist ein Drama von Friedrich Schiller. Das Stück wurde am 11. September 1801 im Comödienhaus auf der Rannischen Bastei in Leipzig uraufgeführt. Es nimmt den Stoff um die französische Heilige Johanna von Orléans auf und war zu Lebzeiten Schillers eines seiner am häufigsten gespielten Stücke. Legationsrat: Amtstitel höherer Beamter Mauskönig: Napoleon war (seit dem 15. Juli 1815) bereits endgültig auf die Insel St. Helena im Atlantischen Ozean verbannt worden und damit zur Machtlosigkeit verurteilt. Auch dieses Ereignis wurde von der politischen Pamphletliteratur und Bildpublizistik in Europa mit Hohn und Spott begleitet und der Lächerlichkeit preisgegeben. Da die einsame Insel St. Helena allgemein als Insel der Ratten und Mäuse galt, stellte man den zuvor mächtigsten Herrscher Europas in sehr zahlreichen Karikaturen als Feldherrn über Heere von Ratten oder Mäusen dar, mithin als Ratten- oder Mausekönig.
So zeigt ihn ein anonymes Blatt aus dem Jahr 1815 in Feldherrnpose statt auf seinem Schlachtroß auf einer Ratte sitzend; die beiden nehmen fast die ganze Insel ein – so klein ist sie ...
Unter dem Titel Die größte Helden hat des neunzehnten Jahrhunderts oder Eroberung der Insel St. Helena sieht man auf einem anderen Bild Napoleon säbelschwingend und auf einem Geißbock reitend als Heerführer von Katzen eine Armee von Ratten oder Mäusen in die Flucht schlagen. Es handelt sich um eine satirische Variante der sogenannten Katomyomachia, also des Katzen-Mäusekriegs, der schon in der Fabeldichtung des Äsop begegnet und in der europäischen Literatur und Kunst zur satirischen Darstellung kriegerischer Ereignisse immer wieder aufgegriffen wurde.
Gardehusarenmarsch:
Unter einem Kavalleriemarsch versteht man ein Werk der militärischen
Marschmusik, das ursprünglich der musikalischen Untermalung der Bewegung
berittener Truppen (Kavallerie, Feldartillerie) im Feld und bei Paraden
diente. Aufgrund der besonderen Rhythmik des Pferdeschritts wurden solche
Märsche meist im 6/8-Takt verfasst, der harte 2/4- bzw. 4/4-Takt der
Infanteriemärsche war dazu wenig geeignet. Auch die Besetzung der
Kavallerietrompeterkorps (Fanfaren, Pauken) unterschied sich wesentlich von
ihren Gegenparts bei den Fußtruppen (Trompeten, Pfeifen, kleine Trommeln).
einen alten Obristen: Obrist, frühneuzeitlicher
Regimentschef oder Regimentsinhaber, auch Kurzform für Obristfeldhauptmann.
Obrist, Titel des frühneuzeitlichen Obristlieutenants im 17. und 18.
Jahrhundert, militärischer Kommandeur für den Regimentsinhaber. Demoiselle Stahlbaum: als Kurzform von Mademoiselle französische Anrede für junge weibliche Personen
|
Auf einer weiteren Karikatur erscheint Napoleon als Der neue Robinson auf der einsamen Ratten Insel im Süd-Meere St. Helena genannt. Er sitzt, von Ratten umgeben, ironishcerweise mit einen Jakobinermütze auf dem Kopf unter einem Sonnenschirm aus dem Stoff der Tricolore u nd hält Zwiesprache mit seinem Papagei; der redet ihn an: „Nap, armer Nap! In einer Schlafhaube? Wo hast du denn deinen pfiffigen Hut gelassen?“ Und Napoleon erwidert: „Ach, Hut und Degen, Krone und Scepter gingen bei la Belle Alliance verlohren!“ Mit den Insignien der einstigen Macht spielen nun die Ratten; die Trommel, auf der Napoleon sitzt, trägt die Inschrift „Nun lärmts Ding nicht mehr“, und auf dem Blasebalg, an den sich Napoleon lehnt, ist zu lesen: „Der zweite Theil meines Lebens“.
Die
beiden Blätter, die Napoleons Verbannung auf St. Helena thematisieren,
stammen ebenfalls, wie das vorangegangene, von Karikaturisten Johann Michael
Voltz. Das eine ist betitelt Des großen Mannes kleine Hofhaltung auf der
glücklichen Insel und zeig Napoleon während der Morgentoilette, bei der
ihm auf Stelzen gehende Mäuse oder Ratten zur Hand gehen: Sie schleppen
seine Stiefel herbei, rasieren und frisieren ihn, schreiben oder zeichnen
etwas auf undsoweiter. In seiner rechten Hand hält Napoleon die
Niederschrift „St. Helenischer Moniteur oder Gespräche im Reiche der Todten“
(eine damals beliebte literarische Form der politischen Publizistik), in der
Linken hält er eine Papierrolle, auf der seine „Plane“ der Welteroberung
stehen; bei genauem Hinsehen kann man erkennen, daß u.a. die Eroberung
Chinas und Japans geplant waren. Im Hintergrund ist ein Stammbaum Napoleons
zu sehen, auf dem neben dem Großen Napoleon vier weitere Napoleone
verzeichne, sind, womit seine drei Brüder und sein Schwager Murat gemeint
sind, die er alle zu Königen gemacht hatte. - Die andere Karikatur stellt
dar, Wie der – dies Jahr in Europa nicht mehr gefeyerte – Napoleons- Tag auf
der Insel St. Helena festlich begangen wird. Der Geburtstag Napoleons, der
15. August, wurde, solange Napoleon Kaiser war, überall in Europa festlich
begangen mit Aufmärschen und Paraden, Huldigungen, Ordensverleihungen,
Salutschüssen usw. Alles das findet – nach der Vorstellung des
Karikaturisten - auch auf der Insel St. Helena statt: Der Herrscher und
Regent Napoleon, unter einem Baldachin in Imperator-Pose stehend, nimmt wie
eh und je die Huldbeweise seiner Untertanen entgegen; nur handelt es sich um
lauter Ratten, deren König er ist.
Wulf Segebrecht 2009, S. 69f.
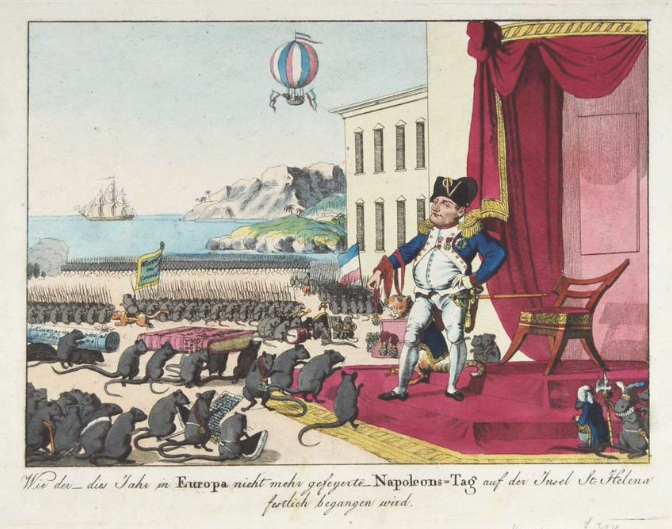

|
Das Puppenreich Ich glaube, keins von euch, ihr Kinder, hätte auch nur einen Augenblick angestanden, dem ehrlichen gutmütigen Nußknacker, der nie Böses im Sinn haben konnte, zu folgen. Marie tat dies um so mehr, da sie wohl wußte, wie sehr sie auf Nußknackers Dankbarkeit Anspruch machen könne, und überzeugt war, daß er Wort halten, und viel Herrliches ihr zeigen werde. Sie sprach daher: „Ich gehe mit Ihnen, Herr Droßelmeier, doch muß es nicht weit sein, und nicht lange dauern, da ich ja noch gar nicht ausgeschlafen habe.“ „Ich wähle deshalb“, erwiderte Nußknacker, „den nächsten, wiewohl etwas beschwerlichen Weg.“ Er schritt voran, Marie ihm nach, bis er vor dem alten mächtigen Kleiderschrank auf dem Hausflur stehenblieb. Marie wurde zu ihrem Erstaunen gewahr, daß die Türen dieses sonst wohl verschlossenen Schranks offenstanden, so daß sie deutlich des Vaters Reisefuchspelz erblickte, der ganz vorne hing. Nußknacker kletterte sehr geschickt an den Leisten und Verzierungen herauf, daß er die große Troddel, die an einer dicken Schnur befestigt, auf dem Rückteile jenes Pelzes hing, erfassen konnte. Sowie Nußknacker diese Troddel stark anzog, ließ sich schnell eine sehr zierliche Treppe von Zedernholz durch den Pelzärmel herab. „Steigen Sie nur gefälligst aufwärts, teuerste Demoiselle“, rief Nußknacker. Marie tat es, aber kaum war sie durch den Ärmel gestiegen, kaum sah sie zum Kragen heraus, als ein blendendes Licht ihr entgegenstrahlte, und sie mit einemmal auf einer herrlich duftenden Wiese stand, von der Millionen Funken, wie blinkende Edelsteine emporstrahlten. „Wir befinden uns auf der Kandiswiese“, sprach Nußknacker, „wollen aber alsbald jenes Tor passieren.“ Nun wurde Marie, indem sie aufblickte, erst das schöne Tor gewahr, welches sich nur wenige Schritte vorwärts auf der Wiese erhob. Es schien ganz von weiß, braun und rosinfarben gesprenkeltem Marmor erbaut zu sein, aber als Marie näher kam, sah sie wohl, daß die ganze Masse aus zusammengebackenen Zuckermandeln und Rosinen bestand, weshalb denn auch, wie Nußknacker versicherte, das Tor, durch welches sie nun durchgingen, das Mandeln- und Rosinentor hieß. Gemeine Leute hießen es sehr unziemlich, die Studentenfutterpforte. Auf einer herausgebauten Galerie dieses Tores, augenscheinlich aus Gerstenzucker, machten sechs in rote Wämserchen gekleidete Äffchen die allerschönste Janitscharenmusik, die man hören konnte, so daß Marie kaum bemerkte, wie sie immer weiter, weiter auf bunten Marmorfliesen, die aber nichts anders waren, als schön gearbeitete Morschellen, fortschritt. Bald umwehten sie die süßesten Gerüche, die aus einem wunderbaren Wäldchen strömten, das sich von beiden Seiten auftat. In dem dunkeln Laube glänzte und funkelte es so hell hervor, daß man deutlich sehen konnte, wie goldene und silberne Früchte an buntgefärbten Stengeln herabhingen, und Stamm und Äste sich mit Bändern und Blumensträußen geschmückt hatten, gleich fröhlichen Brautleuten und lustigen Hochzeitsgästen. Und wenn die Orangendüfte sich wie wallende Zephire rührten, da sauste es in den Zweigen und Blättern, und das Rauschgold knitterte und knatterte, daß es klang wie jubelnde Musik, nach der die funkelnden Lichterchen hüpfen und tanzen müßten. „Ach, wie schön ist es hier“, rief Marie ganz selig und entzückt. „Wir sind im Weihnachtswalde, beste Demoiselle“, sprach Nußknackerlein. „Ach“, fuhr Marie fort, „dürft ich hier nur etwas verweilen, o es ist ja hier gar zu schön.“ Nußknacker klatschte in die kleinen Händchen und sogleich kamen einige kleine Schäfer und Schäferinnen, Jäger und Jägerinnen herbei, die so zart und weiß waren, daß man hätte glauben sollen, sie wären von purem Zucker und die Marie, unerachtet sie im Walde umherspazierten, noch nicht bemerkt hatte. Sie brachten einen allerliebsten ganz goldenen Lehnsessel herbei, legten ein weißes Kissen von Reglisse darauf, und luden Marien sehr höflich ein, sich darauf niederzulassen. Kaum hatte sie es getan, als Schäfer und Schäferinnen ein sehr artiges Ballett tanzten, wozu die Jäger ganz manierlich bliesen, dann verschwanden sie aber alle in dem Gebüsche. „Verzeihen Sie“, sprach Nußknacker, „verzeihen Sie, werteste Demoiselle Stahlbaum, daß der Tanz so miserabel ausfiel, aber die Leute waren alle von unserm Drahtballett, die können nichts anders machen als immer und ewig dasselbe: und daß die Jäger so schläfrig und flau dazu bliesen, das hat auch seine Ursachen. Der Zuckerkorb hängt zwar über ihrer Nase in den Weihnachtsbäumen, aber etwas hoch! – Doch wollen wir nicht was weniges weiterspazieren?“ „Ach es war doch alles recht hübsch und mir hat es sehr wohl gefallen!“ so sprach Marie, indem sie aufstand und dem voranschreitenden Nußknacker folgte. Sie gingen entlang eines süß rauschenden, flüsternden Baches, aus dem nun eben all die herrlichen Wohlgerüche zu duften schienen, die den ganzen Wald erfüllten. „Es ist der Orangenbach“, sprach Nußknacker auf Befragen, „doch seinen schönen Duft ausgenommen, gleicht er nicht an Größe und Schönheit dem Limonadenstrom, der sich gleich ihm in den Mandelmilchsee ergießt.“ In der Tat vernahm Marie bald ein stärkeres Plätschern und Rauschen und erblickte den breiten Limonadenstrom, der sich in stolzen isabellfarbenen Wellen zwischen gleich grün glühenden Karfunkeln leuchtendem Gesträuch fortkräuselte. Eine ausnehmend frische, Brust und Herz stärkende Kühlung wogte aus dem herrlichen Wasser. Nicht weit davon schleppte sich mühsam ein dunkelgelbes Wasser fort, das aber ungemein süße Düfte verbreitete und an dessen Ufer allerlei sehr hübsche Kinderchen saßen, welche kleine dicke Fische angelten und sie alsbald verzehrten. Näher gekommen bemerkte Marie, daß diese Fische aussahen wie Lampertsnüsse. In einiger Entfernung lag ein sehr nettes Dörfchen an diesem Strome, Häuser, Kirche, Pfarrhaus, Scheuern, alles war dunkelbraun, jedoch mit goldenen Dächern geschmückt, auch waren viele Mauern so bunt gemalt, als seien Zitronat und Mandelkerne daraufgeklebt. „Das ist Pfefferkuchheim“, sagte Nußknacker, „welches am Honigstrome liegt, es wohnen ganz hübsche Leute darin, aber sie sind meistens verdrießlich, weil sie sehr an Zahnschmerzen leiden, wir wollen daher nicht erst hineingehen.“ In dem Augenblick bemerkte Marie ein Städtchen, das aus lauter bunten durchsichtigen Häusern bestand, und sehr hübsch anzusehen war. Nußknacker ging geradezu darauf los, und nun hörte Marie ein tolles lustiges Getöse und sah wie tausend niedliche kleine Leutchen viele hochbepackte Wagen, die auf dem Markte hielten, untersuchten und abzupacken im Begriff standen. Was sie aber hervorbrachten, war anzusehen wie buntes gefärbtes Papier und wie Schokoladetafeln. „Wir sind in Bonbonshausen“, sagte Nußknacker, „eben ist eine Sendung aus dem Papierlande und vom Schokoladenkönige angekommen. Die armen Bonbonshäuser wurden neulich von der Armee des Mückenadmirals hart bedroht, deshalb überziehen sie ihre Häuser mit den Gaben des Papierlandes und führen Schanzen auf, von den tüchtigen Werkstücken, die ihnen der Schokoladenkönig sandte. Aber beste Demoiselle Stahlbaum, nicht alle kleinen Städte und Dörfer dieses Landes wollen wir besuchen – zur Hauptstadt – zur Hauptstadt!“ – Rasch eilte Nußknacker vorwärts, und Marie voller Neugierde ihm nach. Nicht lange dauerte es, so stieg ein herrlicher Rosenduft auf und alles war wie von einem sanften hinhauchenden Rosenschimmer umflossen. Marie bemerkte, daß dies der Widerschein eines rosenrot glänzenden Wassers war, das in kleinen rosasilbernen Wellchen vor ihnen her wie in wunderlieblichen Tönen und Melodien plätscherte und rauschte. Auf diesem anmutigen Gewässer, das sich immer mehr und mehr wie ein großer See ausbreitete, schwammen sehr herrliche silberweiße Schwäne mit goldnen Halsbändern, und sangen miteinander um die Wette die hübschesten Lieder, wozu diamantne Fischlein aus den Rosenfluten auf- und niedertauchten ,wie im lustigen Tanze. „Ach“, rief Marie ganz begeistert aus, „ach das ist der See, wie ihn Pate Droßelmeier mir einst machen wollte, wirklich, und ich selbst bin das Mädchen, das mit den lieben Schwänchen kosen wird.“ Nußknackerlein lächelte so spöttisch, wie es Marie noch niemals an ihm bemerkt hatte, und sprach dann: „So etwas kann denn doch wohl der Onkel niemals zustande bringen; Sie selbst viel eher, liebe Demoiselle Stahlbaum, doch lassen Sie uns darüber nicht grübeln, sondern vielmehr über den Rosensee hinüber nach der Hauptstadt schiffen.“
|
Das »Puppenreich« Mit
Maries Besuch in der Parallelwelt des Nussknackers eröffnet sich die
phantastische Sphäre des Textes, zwischen der Marie und der Nussknacker
oszillieren und die Elemente aller Erzählebenen miteinander vereint. Ob
Maries Erlebnissen im Puppen- und Feenreich, das mit seinem
»Limonadenstrom«, »Mandelmilchsee« und »Honigstrome« an ein Schlaraffenland
erinnert, der Status der Realität zukommt, bleibt unsicher. Im Anschluss an das Märchen hält Marie die Geschichte des Paten für wahr und versucht, den Fluch des Nußknackers aufzuheben. Sie opfert zu diesem Zwecke all ihre Süßigkeiten dem erpresserischen Mausekönig, der sie des nachts immer wieder aufsucht und ihr droht, andernfalls den geliebten Nußknacker zu zerbeißen. Der Nußknacker besiegt jedoch in einem finalen Kampf den Erzfeind und führt Marie zum Dank für ihre Loyalität und Verluste durch einen Pelzärmel im Kleiderschrank in das »Puppenreich«. Dort reisen sie über die »Kandiswiese« durch die »Studentenfutterpforte« und anderen süßen Orten wie »Pfefferkuchenheim« in der Nähe des »Limonadenstroms« Richtung der Hauptstadt ins Marzipanschloss. Dort angekommen, nehmen die königlichen Schwestern des Nußknackers Marie in ihre Reihen auf, um ihr dafür zu danken, dass sie sein Leben gerettet hat. Marie berichtet ihrer Familie von ihren nächtlichen
Erlebnissen, die sie sogleich für eine Träumerin halten, doch sie hält an
ihrer Überzeugung fest. Zum Schluss des Märchens stellt der Pate Droßelmeier
der Familie Stahlbaum seinen Neffen vor, der erstaunliche Ähnlichkeit mit
dem Nußknacker besitzt. Marie und der junge Droßelmeier verloben sich und es
bleibt unklar, inwiefern es sich dabei um den entzauberten Nußknacker
handelt. Übergang in eine andere Welt
Roberto Innocenti. Illustration zu Nußknacker und Mausekönig. 1996.
Morschellen:
Die Speise- oder Rund-Morchel (Morchella
esculenta) ist eine Schlauchpilzart (Ascomycota) aus der Familie der
Morchelverwandten (Morchellaceae). Sie entwickelt im Frühjahr große, in Hut
und Stiel gegliederte Fruchtkörper mit einem wabigen Hut in gelblichen,
gräulichen oder bräunlichen Tönen in Schattierungen von blass bis braun. Sie
ist ein sehr begehrter Speisepilz mit hohem Wiedererkennungswert. Sie wird
auch getrocknet gehandelt.
Zephire: Zephyr (auch Zephyros „Zephir“ oder
Zephyrus, altgriechisch Ζέφυρος Zéphyros, deutsch ‚der vom Berge Kommende‘)
ist einer der Anemoi, eine Windgottheit aus der griechischen Mythologie, die
den (milden) Westwind verkörpert. In der Antike wurde Zephyr als
Frühlingsbote und „Reifer der Saaten“ verehrt. Rauschgold: sehr dünn gewalztes und gehämmertes Messingblech Marie ist hingerissen von den Spiegelungen, die sie im
See sieht, und wieder muss der Nussknacker ihr alles erklären und sagen,
dass sie nicht Prinzessin Pirlipat, sondern immer nur sich selbst sieht. Die
Stadt, die sie erreichen, ist Konfektburg, die Stadt der Süßigkeiten, wo es
hübsch gekleidete Damen und Herren, Armenier und Griechen, Juden und
Tiroler, Offiziere, Soldaten, Geistliche, Hirten und Clowns und alle Arten
von Menschen auf der Welt gibt. Marie mag sie in Spielzeugform gekannt
haben, aber mit der konkreten Nennung der Armenier, Griechen, Juden und
Tiroler spielt Hoffmann auf die Probleme der Gegenwart an. Sowohl die
Armenier als auch die Griechen versuchten, ihre Unabhängigkeit vom
Osmanischen Reich zu etablieren, während die Tiroler unter der Führung von
Andreas Hofer mit Hofers Tod 1810 ihren Kampf um die Unabhängigkeit verloren
hatten. Doch Marie träumt von einem friedlichen Königreich, das es nur in
Märchen oder im Reich utopischer Begierden gibt. Hinter der turbulenten
Vielfalt, die Marie sieht, steckt der Konditor, der Konditor, der der
Begründer von allem ist – „eine unbekannte, aber ganz unheimliche Macht, von
der die Leute glauben, dass sie aus dem Menschen machen kann, was sie will“.
Reglisse:
Echtes Süßholz ist eine Pflanzenart aus der
Unterfamilie Schmetterlingsblütler innerhalb der Familie der Hülsenfrüchtler.
Am bekanntesten ist das Echte Süßholz durch die aus der Süßholzwurzel
gewonnene Süßigkeit Lakritze. Drahtballett: Tanzvorführung von Marionetten isabellfarbenen: lehmfarben, graugelb, nach der span. Prinzessin Isabella, Tochter Philipps II., die gelobt haben soll, ihr Hemd nicht eher zu wechseln, als bis ihr Gemahl, der Erzherzog Albrecht von Österreich, das belagerte Ostende erobert habe. Karfunkeln: feuerroter Edelstein (der im Märchen durch die Kraft ausgezeichnet ist, den Träger unsichtbar zu machen)
Lampertsnüsse:
Die Lambertshasel (Corylus maxima) ist eine Pflanzenart aus der Gattung
Hasel (Corylus) innerhalb der Familie Birkengewächse (Betulaceae).
|
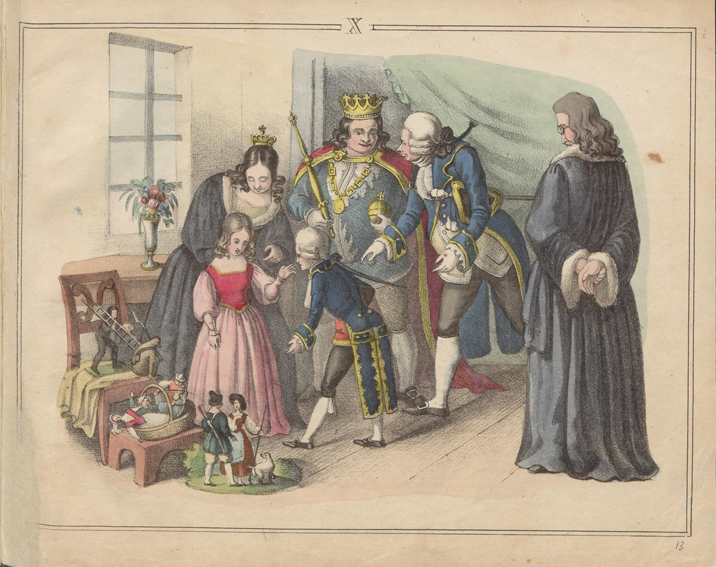
|
Die Hauptstadt Nußknackerlein klatschte abermals in die kleinen Händchen, da fing der Rosensee an stärker zu rauschen, die Wellen plätscherten höher auf, und Marie nahm wahr, wie aus der Ferne ein aus lauter bunten, sonnenhell funkelnden Edelsteinen geformter Muschelwagen, von zwei goldschuppigen Delphinen gezogen, sich nahte. Zwölf kleine allerliebste Mohren mit Mützchen und Schürzchen, aus glänzenden Kolibrifedern gewebt, sprangen ans Ufer und trugen erst Marien, dann Nußknackern, sanft über die Wellen gleitend, in den Wagen, der sich alsbald durch den See fortbewegte. Ei wie war das so schön, als Marie im Muschelwagen, von Rosenduft umhaucht, von Rosenwellen umflossen, dahinfuhr. Die beiden goldschuppigen Delphine erhoben ihre Nüstern und spritzten kristallene Strahlen hoch in die Höhe, und wie die in flimmernden und funkelnden Bogen niederfielen, da war es, als sängen zwei holde feine Silberstimmchen: „Wer schwimmt auf rosigem See? – die Fee! Mücklein! bim bim Fischlein, sim sim – Schwäne! Schwa schwa, Goldvogel! trarah, Wellenströme – rührt euch, klinget, singet, wehet, spähet – Feelein, Feelein kommt gezogen; Rosenwogen, wühlet, kühlet, spület – spült hinan – hinan!“ – Aber die zwölf kleinen Mohren, die hinten auf den Muschelwagen aufgesprungen waren, schienen das Gesinge der Wasserstrahlen ordentlich übelzunehmen, denn sie schüttelten ihre Sonnenschirme so sehr, daß die Dattelblätter, aus denen sie geformt waren, durcheinander knitterten und knatterten, und dabei stampften sie mit den Füßen einen ganz seltsamen Takt, und sangen – „Klapp und klipp und klipp und klapp, auf und ab – Mohrenreigen darf nicht schweigen; rührt euch Fische – rührt euch Schwäne, dröhne Muschelwagen, dröhne, klapp und klipp und klipp und klapp und auf und ab!“ – „Mohren sind gar lustige Leute“, sprach Nußknacker etwas betreten, „aber sie werden mir den ganzen See rebellisch machen.“ In der Tat ging auch bald ein sinnverwirrendes Getöse wunderbarer Stimmen los, die in See und Luft zu schwimmen schienen, doch Marie achtete dessen nicht, sondern sah in die duftenden Rosenwellen, aus deren jeder ihr ein holdes anmutiges Mädchenantlitz entgegenlächelte. „Ach“, rief sie freudig, indem sie die kleinen Händchen zusammenschlug: „ach schauen Sie nur, lieber Herr Droßelmeier! Da unten ist die Prinzessin Pirlipat, die lächelt mich an so wunderhold. – Ach schauen Sie doch nur, lieber Herr Droßelmeier!“ – Nußknacker seufzte aber fast kläglich und sagte: „O beste Demoiselle Stahlbaum, das ist nicht die Prinzessin Pirlipat, das sind Sie und immer nur Sie selbst, immer nur Ihr eignes holdes Antlitz, das so lieb aus jeder Rosenwelle lächelt.“ Da fuhr Marie schnell mit dem Kopf zurück, schloß die Augen fest zu und schämte sich sehr. In demselben Augenblick wurde sie auch von den zwölf Mohren aus dem Muschelwagen gehoben und an das Land getragen. Sie befand sich in einem kleinen Gebüsch, das beinahe noch schöner war als der Weihnachtswald, so glänzte und funkelte alles darin, vorzüglich waren aber die seltsamen Früchte zu bewundern, die an allen Bäumen hingen, und nicht allein seltsam gefärbt waren, sondern auch ganz wunderbar dufteten. „Wir sind im Konfitürenhain“, sprach Nußknacker, „aber dort ist die Hauptstadt.“ Was erblickte Marie nun! Wie werd ich es denn anfangen, euch, ihr Kinder die Schönheit und Herrlichkeit der Stadt zu beschreiben, die sich jetzt breit über einen reichen Blumenanger hin vor Mariens Augen auftat. Nicht allein daß Mauern und Türme in den herrlichsten Farben prangten, so war auch wohl, was die Form der Gebäude anlangt, gar nichts Ähnliches auf Erden zu finden. Denn statt der Dächer hatten die Häuser zierlich geflochtene Kronen aufgesetzt, und die Türme sich mit dem zierlichsten buntesten Laubwerk gekränzt, das man nur sehen kann. Als sie durch das Tor, welches so aussah, als sei es von lauter Makronen und überzuckerten Früchten erbaut, gingen, präsentierten silberne Soldaten das Gewehr und ein Männlein in einem brokatnen Schlafrock warf sich dem Nußknacker an den Hals mit den Worten:“ Willkommen, bester Prinz, willkommen in Konfektburg!“ Marie wunderte sich nicht wenig, als sie merkte, daß der junge Droßelmeier von einem sehr vornehmen Mann als Prinz anerkannt wurde. Nun hörte sie aber so viel feine Stimmchen durcheinandertoben, solche ein Gejuchze und Gelächter, solch ein Spielen und Singen, daß sie an nichts anders denken konnte, sondern nur gleich Nußknackerchen fragte, was denn das zu bedeuten habe? „O beste Demoiselle Stahlbaum“, erwiderte Nußknacker: „das ist nichts Besonderes, Konfektburg ist eine volkreiche lustige Stadt, da geht's alle Tage so her, kommen Sie aber nur gefälligst weiter.“ Kaum waren sie einige Schritte gegangen, als sie auf den großen Marktplatz kamen, der den herrlichsten Anblick gewährte. Alle Häuser ringsumher waren von durchbrochener Zuckerarbeit, Galerie über Galerie getürmt, in der Mitte stand ein hoher überzuckerter Baumkuchen als Obelisk und um ihn her sprützten vier sehr künstliche Fontänen, Orsade, Limonade und andere herrliche süße Getränke in die Lüfte; und in dem Becken sammelte sich lauter Creme, den man gleich hätte auslöffeln mögen. Aber hübscher als alles das, waren die allerliebsten kleinen Leutchen, die sich zu Tausenden Kopf an Kopf durcheinanderdrängten und juchzten und lachten und scherzten und sangen, kurz jenes lustige Getöse erhoben, das Marie schon in der Ferne gehört hatte. Da gab es schöngekleidete Herren und Damen, Armenier und Griechen, Juden und Tiroler, Offiziere und Soldaten, und Prediger und Schäfer und Hanswürste, kurz alle nur mögliche Leute, wie sie in der Welt zu finden sind. An der einen Ecke wurde größer der Tumult, das Volk strömte auseinander, denn eben ließ sich der Großmogul auf einem Palankin vorübertragen, begleitet von dreiundneunzig Großen des Reichs und siebenhundert Sklaven. Es begab sich aber, daß an der andern Ecke die Fischerzunft, an fünfhundert Köpfe stark, ihren Festzug hielt und übel war es auch, daß der türkische Großherr gerade den Einfall hatte, mit dreitausend Janitscharen über den Markt spazierenzureiten, wozu noch der große Zug aus dem unterbrochenen Opferfeste kam, der mit klingendem Spiel und dem Gesange: „Auf danket der mächtigen Sonne“, gerade auf den Baumkuchen zuwallte. Das war ein Drängen und Stoßen und Treiben und Gequieke! – Bald gab es auch viel Jammergeschrei, denn ein Fischer hatte im Gedränge einem Brahmin den Kopf abgestoßen und der Großmogul wäre beinahe von einem Hanswurst überrannt worden. Toller und toller wurde der Lärm und man fing bereits an sich zu stoßen und zu prügeln, als der Mann im brokatnen Schlafrock, der am Tor den Nußknacker als Prinz begrüßt hatte, auf den Baumkuchen kletterte, und nachdem eine sehr hell klingende Glocke dreimal angezogen worden, dreimal laut rief: „Konditor! Konditor! – Konditor!“ – Sogleich legte sich der Tumult, ein jeder suchte sich zu behelfen wie er konnte, und nachdem die verwickelten Züge sich entwickelt hatten, der besudelte Großmogul abgebürstet, und dem Brahmin der Kopf wieder aufgesetzt worden, ging das vorige lustige Getöse aufs neue los. „Was bedeutet das mit dem Konditor, guter Herr Droßelmeier“, fragte Marie. „Ach beste Demoiselle Stahlbaum“, erwiderte Nußknacker, „Konditor wird hier eine unbekannte, aber sehr greuliche Macht genannt, von der man glaubt, daß sie aus dem Menschen machen könne was sie wolle; es ist das Verhängnis, welches über dies kleine lustige Volk regiert, und sie fürchten dieses so sehr, daß durch die bloße Nennung des Namens der größte Tumult gestillt werden kann, wie es eben der Herr Bürgermeister bewiesen hat. Ein jeder denkt dann nicht mehr an Irdisches, an Rippenstöße und Kopfbeulen, sondern geht in sich und spricht: ›Was ist der Mensch und was kann aus ihm werden?‹“ – Eines lauten Rufs der Bewunderung, ja des höchsten Erstaunens konnte sich Marie nicht enthalten, als sie jetzt mit einemmal vor einem in rosenrotem Schimmer hell leuchtenden Schlosse mit hundert luftigen Türmen stand. Nur hin und wieder waren reiche Bouquets von Veilchen, Narzissen, Tulpen, Levkojen auf die Mauern gestreut, deren dunkelbrennende Farben nur die blendende, ins Rosa spielende Weiße des Grundes erhöhten. Die große Kuppel des Mittelgebäudes, sowie die pyramidenförmigen Dächer der Türme waren mit tausend golden und silbern funkelnden Sternlein besäet. „Nun sind wir vor dem Marzipanschloß“, sprach Nußknacker. Marie war ganz verloren in dem Anblick des Zauberpalastes, doch entging es ihr nicht, daß das Dach eines großen Turmes gänzlich fehlte, welches kleine Männerchen, die auf einem von Zimtstangen erbauten Gerüste standen, wiederherstellen zu wollen schienen. Noch ehe sie den Nußknacker darum befragte, fuhr dieser fort. „Vor kurzer Zeit drohte diesem schönen Schloß arge Verwüstung, wo nicht gänzlicher Untergang. Der Riese Leckermaul kam des Weges gegangen, biß schnell das Dach jenes Turmes herunter und nagte schon an der großen Kuppel, die Konfektbürger brachten ihm aber ein ganzes Stadtviertel, sowie einen ansehnlichen Teil des Konfitürenhains als Tribut, womit er sich abspeisen ließ und weiterging.“ In dem Augenblick ließ sich eine sehr angenehme sanfte Musik hören, die Tore des Schlosses öffneten sich und es traten zwölf kleine Pagen heraus mit angezündeten Gewürznelkstengeln, die sie wie Fackeln in den kleinen Händchen trugen. Ihre Köpfe bestanden aus einer Perle, die Leiber aus Rubinen und Smaragden und dazu gingen sie auf sehr schön aus purem Gold gearbeiteten Füßchen einher. Ihnen folgten vier Damen, beinahe so groß als Mariens Clärchen, aber so über die Maßen herrlich und glänzend geputzt, daß Marie nicht einen Augenblick in ihnen die gebornen Prinzessinnen verkannte. Sie umarmten den Nußknacker auf das zärtlichste und riefen dabei wehmütig freudig: „O mein Prinz! – mein bester Prinz! – o mein Bruder!“ Nußknacker schien sehr gerührt, er wischte sich die sehr häufigen Tränen aus den Augen, ergriff dann Marien bei der Hand und sprach pathetisch „Dies ist die Demoiselle Marie Stahlbaum, die Tochter eines sehr achtungswerten Medizinalrates, und die Retterin meines Lebens! Warf sie nicht den Pantoffel zur rechten Zeit, verschaffte sie mir nicht den Säbel des pensionierten Obristen, so läg ich, zerrissen von dem fluchwürdigen Mausekönig, im Grabe. – Oh! dieser Demoiselle Stahlbaum! gleicht ihr wohl Pirlipat, obschon sie eine geborne Prinzessin ist, an Schönheit, Güte und Tugend? – Nein, sag ich, nein!“ Alle Damen riefen: „Nein!“ und fielen der Marie um den Hals und riefen schluchzend: „O Sie edle Retterin des geliebten prinzlichen Bruders – vortreffliche Demoiselle Stahlbaum!“ – Nun geleiteten die Damen Marien und den Nußknacker in das Innere des Schlosses, und zwar in einen Saal, dessen Wände aus lauter farbig funkelnden Kristallen bestanden. Was aber vor allem übrigen der Marie so wohlgefiel, waren die allerliebsten kleinen Stühle, Tische, Kommoden, Sekretärs u. s. w. die ringsherum standen, und die alle von Zedern- oder Brasilienholz mit daraufgestreuten goldnen Blumen verfertigt waren. Die Prinzessinnen nötigten Marien und den Nußknacker zum Sitzen, und sagten, daß sie sogleich selbst ein Mahl bereiten wollten. Nun holten sie eine Menge kleiner Töpfchen und Schüsselchen von dem feinsten japanischen Porzellan, Löffel, Messer und Gabeln, Reibeisen, Kasserollen und andere Küchenbedürfnisse von Gold und Silber herbei. Dann brachten sie die schönsten Früchte und Zuckerwerk, wie es Marie noch niemals gesehen hatte, und fingen an, auf das zierlichste mit den kleinen schneeweißen Händchen die Früchte auszupressen, das Gewürz zu stoßen, die Zuckermandeln zu reiben, kurz so zu wirtschaften, daß Marie wohl einsehen konnte, wie gut sich die Prinzessinnen auf das Küchenwesen verstanden, und was das für ein köstliches Mahl geben würde. Im lebhaften Gefühl, sich auf dergleichen Dinge ebenfalls recht gut zu verstehen, wünschte sie heimlich, bei dem Geschäft der Prinzessinnen selbst tätig sein zu können. Die schönste von Nußknackers Schwestern, als ob sie Mariens geheimen Wunsch erraten hätte, reichte ihr einen kleinen goldnen Mörser mit den Worten hin: „O süße Freundin, teure Retterin meines Bruders, stoße eine Wenigkeit von diesem Zuckerkandel!“ Als Marie nun so wohlgemut in den Mörser stieß, daß er gar anmutig und lieblich, wie ein hübsches Liedlein ertönte, fing Nußknacker an sehr weitläuftig zu erzählen, wie es bei der grausenvollen Schlacht zwischen seinem und des Mausekönigs Heer ergangen, wie er der Feigheit seiner Truppen halber geschlagen worden, wie dann der abscheuliche Mausekönig ihn durchaus zerreißen wollen, und Marie deshalb mehrere seiner Untertanen, die in ihre Dienste gegangen, aufopfern müssen u. s. w. Marien war es bei dieser Erzählung, als klängen seine Worte, ja selbst ihre Mörserstöße, immer ferner und unvernehmlicher, bald sah sie silberne Flöte wie dünne Nebelwolken aufsteigen, in denen die Prinzessinnen – die Pagen, der Nußknacker, ja sie selbst schwammen – ein seltsames Singen und Schwirren und Summen ließ sich vernehmen, das wie in die
Weite hin verrauschte nun hob sich Marie wie auf steigenden Wellen immer höher und höher – höher und höher – höher und höher – |
Mohren: Mohr ist eine veraltete
deutschsprachige Bezeichnung für Afrikaner. Historisch (alt- und
mittelhochdeutsch) bezeichnete man damit zunächst die Mauren als Bewohner
des antiken und mittelalterlichen Nordafrika; bereits im Mittelalter aber
auch schon verallgemeinernd Menschen mit dunkler Hautfarbe, ab dem 16.
Jahrhundert zunehmend in dieser erweiterten Bedeutung.
Blumenanger: Blumenwiese brokatnen: Unter Brokat (ital. broccato, zu broccare „durchwirken“ versteht man ein schweres, festes und gemustertes textiles Gewebe aus Seide, in das Gold- oder Silberfäden eingewoben sind (Gold- oder Silberbrokat).
Obelisk: Ein
Obelisk (Plural Obelisken; über lateinisch obeliscus von griechisch ὀβελίσκος
obelískos, dem Deminutiv von ὀβελός obelós, deutsch ‚Spitzsäule, [Brat]spieß‘)
ist ein freistehender hoher, nach oben verjüngter, in ursprünglicher
Herstellungsart monolithischer Steinpfeiler (Stele), der eine
pyramidenförmige Spitze hat, das Pyramidion. Neuzeitliche Obelisken sind
zumeist aus mehreren Steinen zusammengesetzt, selten monolithisch.
Orsade:
Orsade (auch Orgeade, Gerstentrank,
Gerstenwasser oder Ptisane genannt) ist eine dünne schleimige Brühe aus
gekochter Gerste oder Gerstengraupen.
Hanswürste: Der
Hanswurst (auch Hans Wurst) ist eine derb-komische Gestalt der
deutschsprachigen Stegreifkomödie seit dem 16. Jahrhundert (Hans worst). Als
populäre bäuerliche Figur trat der Hanswurst in Stücken des
Jahrmarktstheaters und der Wanderbühnen auf. Großmogul auf einem Palankin: Tragbarer Thron der indischen Mogul Kaiser der große Zug aus dem unterbrochenen Opferfeste: Hoffman schrieb 1815 eine Besprechung der komischen Oper Das unterbrochene Osterfest von Peter Winter, das er in Bamberg mehrfach gesehen hatte. (Dramaturgisches Wochenblatt in nächster Beziehung auf die Königlichen Schauspiele zu Berlin vom 23.9.1815.)
Peter von
Winter (bis 1814 Peter Winter; getauft 28. August 1754 in Mannheim; † 17.
Oktober 1825 in München) war ein deutscher Komponist, Gesangslehrer und
Kapellmeister.
Janitscharen:
Die Janitscharen waren im Osmanischen Reich
die Elitetruppe der Armee. Sie stellten die Leibwache des Sultans und
erreichten höchste Positionen im osmanischen Staatswesen. Brahmin: gebildete kultivierte Person
Brasilienholz:
Als Rotholz oder auch Brasilholz werden roten Farbstoff (Brasilin, Santalin
u. a.) liefernde Baumarten mit rötlichem Kernholz bezeichnet, hauptsächlich
aus den Baumarten der Gattung (Caesalpina spp.) Caesalpinien. Der Ausdruck
wird auch für andere Tropenhölzer verwendet.
Zuckerkandel: Mit
Kandis oder Kandiszucker werden Kristalle aus Zucker bezeichnet, die aus
konzentrierten Zuckerlösungen in mehreren Tagen auskristallisieren. Das Wort
Kandis geht auf altindisch khaṇḍa („Teil, Bruchstück“, insbesondere auch
„Bruchzucker“; zur Wurzel khaṇḍ- „brechen“) zurück. Über das Arabische (qand
„Rohrzucker“, auch „durch Kochen eingedickter Zuckersaft, Melasse“, bzw.
qandī [adj.] „aus Rohrzucker“) gelangte das Wort im Spätmittelalter ins
Mittellateinische und die romanischen Sprachen, also ins Spanische,
Portugiesische, Provenzalische und Französische ([sucre] candi hier bereits
1256 bezeugt; daraus niederländisch kandij, kandijsuiker und englisch candy)
sowie ins Italienische ([zucchero] candito, 14. Jahrhundert) und von dort
ins Deutsche, wo es wie auch in den anderen europäischen Sprachen zumeist in
zusammengesetzten Formen begegnet (erstmals gegen 1400 als zocker kandis,
später auch als zuckerkandi, zuckerkandit oder zuckerkandil, seit dem 18.
Jahrhundert dann auch als Kandiszucker).
Roberto Innocenti (* 16. Februar 1940 bei
Florenz) ist ein italienischer Illustrator und Autor.
Adrienne
Ségur (1901-1981) war eine französische Kinderbuchillustratorin. Segurs
Illustrationen wurden in den 1950er und 1960er Jahren durch den Verlag
Flammarion bekannt. |
|
Beschluß Prr – Puff ging es! – Marie fiel herab aus unermeßlicher Höhe. – Das war ein Ruck! – Aber gleich schlug sie auch die Augen auf, da lag sie in ihrem Bettchen, es war heller Tag, und die Mutter stand vor ihr, sprechend: „Aber wie kann man auch so lange schlafen, längst ist das Frühstück da!“ Du merkst es wohl, versammeltes, höchst geehrtes Publikum, daß Marie ganz betäubt von all den Wunderdingen, die sie gesehen, endlich im Saal des Marzipanschlosses eingeschlafen war, und daß die Mohren, oder die Pagen oder gar die Prinzessinnen selbst, sie zu Hause getragen und ins Bett gelegt hatten. „O Mutter, liebe Mutter, wo hat mich der junge Herr Droßelmeier diese Nacht überall hingeführt, was habe ich alles Schönes gesehen!“ Nun erzählte sie alles beinahe so genau, wie ich es soeben erzählt habe, und die Mutter sah sie ganz verwundert an. Als Marie geendet, sagte die Mutter: „Du hast einen langen sehr schönen Traum gehabt, liebe Marie, aber schlag dir das alles nur aus dem Sinn.“ Marie bestand hartnäckig darauf, daß sie nicht geträumt, sondern alles wirklich gesehen habe, da führte die Mutter sie an den Glasschrank, nahm den Nußknacker, der, wie gewöhnlich, im dritten Fache stand, heraus und sprach: „Wie kannst du, du albernes Mädchen nur glauben, daß diese Nürnberger Holzpuppe Leben und Bewegung haben kann.“ „Aber, lieber Mutter“, fiel Marie ein, „ich weiß es ja wohl, daß der kleine Nußknacker der junge Herr Droßelmeier aus Nürnberg, Pate Droßelmeiers Neffe ist.“ Da brachen beide der Medizinalrat und die Medizinalrätin in ein schallendes Gelächter aus. „Ach“, fuhr Marie beinahe weinend fort, „nun lachst du gar meinen Nußknacker aus, lieber Vater! und er hat doch von dir sehr gut gesprochen, denn als wir im Marzipanschloß ankamen, und er mich seinen Schwestern, den Prinzessinnen, vorstellte, sagte er, du seist ein sehr achtungswerter Medizinalrat!“ – Noch stärker wurde das Gelächter, in das auch Luise, ja sogar Fritz einstimmte. Da lief Marie ins andere Zimmer, holte schnell aus ihrem kleinen Kästchen die sieben Kronen des Mausekönigs herbei, und überreichte sie der Mutter mit den Worten: „Da sieh nur, liebe Mutter, das sind die sieben Kronen des Mausekönigs, die mir in voriger Nacht der junge Herr Droßelmeier zum Zeichen seines Sieges überreichte.“ Voll Erstaunen betrachtete die Medizinalrätin die kleinen Krönchen, die von einem ganz unbekannten aber sehr funkelnden Metall so sauber gearbeitet waren, als hätten Menschenhände das unmöglich vollbringen können. Auch der Medizinalrat konnte sich nicht satt sehen an den Krönchen, und beide, Vater und Mutter, drangen sehr ernst in Marien, zu gestehen, wo sie die Krönchen herhabe? Sie konnte ja aber nur bei dem, was sie gesagt, stehenbleiben, und als sie nun der Vater hart anließ, und sie sogar eine kleine Lügnerin schalt, da fing sie an heftig zu weinen, und klagte: „Ach ich armes Kind, ich armes Kind! was soll ich denn nun sagen!“ In dem Augenblick ging die Tür auf. Der Obergerichtsrat trat hinein, und rief: „Was ist da – was ist da? mein Patchen Marie weint und schluchzt? – Was ist da – was ist da?“ Der Medizinalrat unterrichtete ihn von allem, was geschehen, indem er ihm die Krönchen zeigte. Kaum hatte der Obergerichtsrat aber diese angesehen, als er lachte, und rief: „Toller Schnack, toller Schnack, das sind ja die Krönchen, die ich vor Jahren an meiner Uhrkette trug, und die ich der kleinen Marie an ihrem Geburtstage, als sie zwei Jahre alt worden, schenkte. Wißt ihr's denn nicht mehr?“ Weder der Medizinalrat noch die Medizinalrätin konnten sich dessen erinnern, als aber Marie wahrnahm, daß die Gesichter der Eltern wieder freundlich geworden, da sprang sie los auf Pate Droßelmeier und rief: „Ach, du weißt ja alles, Pate Droßelmeier, sag es doch nur selbst, daß mein Nußknacker dein Neffe, der junge Herr Droßelmeier aus Nürnberg ist, und daß er mir die Krönchen geschenkt hat! „– Der Obergerichtsrat machte aber ein sehr finsteres Gesicht und murmelte: „Dummer einfältiger Schnack.“ Darauf nahm der Medizinalrat die kleine Marie vor sich und sprach sehr ernsthaft: „Hör mal, Marie, laß nun einmal die Einbildungen und Possen, und wenn du noch einmal sprichst, daß der einfältige mißgestaltete Nußknacker der Neffe des Herrn Obergerichtsrats sei, so werf ich nicht allein den Nußknacker, sondern auch alle deine übrigen Puppen, Mamsell Clärchen nicht ausgenommen, durchs Fenster.“ – Nun durfte freilich die arme Marie gar nicht mehr davon sprechen, wovon denn doch ihr ganzes Gemüt erfüllt war, denn ihr möget es euch wohl denken, daß man solch Herrliches und Schönes, wie es Marien widerfahren, gar nicht vergessen kann. Selbst – sehr geehrter Leser oder Zuhörer Fritz – selbst dein Kamerad Fritz Stahlbaum drehte der Schwester sogleich den Rücken, wenn sie ihm von dem Wunderreiche, in dem sie so glücklich war, erzählen wollte. Er soll sogar manchmal zwischen den Zähnen gemurmelt haben: „Einfältige Gans!“ doch das kann ich seiner sonst erprobten guten Gemütsart halber nicht glauben, so viel ist aber gewiß, daß, da er nun an nichts mehr, was ihm Marie erzählte, glaubte, er seinen Husaren bei öffentlicher Parade das ihnen geschehene Unrecht förmlich abbat, ihnen statt der verlornen Feldzeichen viel höhere, schönere Büsche von Gänsekielen anheftete, und ihnen auch wieder erlaubte, den Gardehusarenmarsch zu blasen. Nun! – wir wissen am besten, wie es mit dem Mut der Husaren aussah, als sie von den häßlichen Kugeln Flecke auf die roten Wämser kriegten! Sprechen durfte nun Marie nicht mehr von ihrem Abenteuer, aber die Bilder jenes wunderbaren Feenreichs umgaukelten sie in süßwogendem Rauschen und in holden lieblichen Klängen; sie sah alles noch einmal, sowie sie nur ihren Sinn fest darauf richtete, und so kam es, daß sie, statt zu spielen, wie sonst, starr und still, tief in sich gekehrt, dasitzen konnte, weshalb sie von allen eine kleine Träumerin gescholten wurde. Es begab sich, daß der Obergerichtsrat einmal eine Uhr in dem Hause des Medizinalrats reparierte, Marie saß am Glasschrank, und schaute, in ihre Träume vertieft, den Nußknacker an, da fuhr es ihr wie unwillkürlich heraus: „Ach, lieber Herr Droßelmeier, wenn Sie doch nur wirklich lebten, ich würd's nicht so machen, wie Prinzessin Pirlipat, und Sie verschmähen, weil Sie, um meinetwillen, aufgehört haben, ein hübscher junger Mann zu sein!“ In dem Augenblick schrie der Obergerichtsrat: „Hei, hei – toller Schnack.“ – Aber in dem Augenblick geschah auch ein solcher Knall und Ruck, daß Marie ohnmächtig vom Stuhle sank. Als sie wieder erwachte, war die Mutter um sie beschäftigt, und sprach: „Aber wie kannst du nur vom Stuhle fallen, ein so großes Mädchen! – Hier ist der Neffe des Herrn Obergerichtsrats aus Nürnberg angekommen – sei hübsch artig!“ – Sie blickte auf, der Obergerichtsrat hatte wieder seine Glasperücke aufgesetzt, seinen gelben Rock angezogen, und lächelte sehr zufrieden, aber an seiner Hand hielt er einen zwar kleinen, aber sehr wohlgewachsenen jungen Mann. Wie Milch und Blut war sein Gesichtchen, er trug einen herrlichen roten Rock mit Gold, weißseidene Strümpfe und Schuhe, hatte im Jabot ein allerliebstes Blumenbouquet, war sehr zierlich frisiert und gepudert, und hinten über den Rücken hing ihm ein ganz vortrefflicher Zopf herab. Der kleine Degen an seiner Seite schien von lauter Juwelen, so blitzte er, und das Hütlein unterm Arm von Seidenflocken gewebt. Welche angenehme Sitten der junge Mann besaß, bewies er gleich dadurch, daß er Marien eine Menge herrlicher Spielsachen, vorzüglich aber den schönsten Marzipan und dieselben Figuren, welche der Mausekönig zerrissen, dem Fritz aber einen wunderschönen Säbel mitgebracht hatte. Bei Tische knackte der Artige für die ganze Gesellschaft Nüsse auf, die härtesten widerstanden ihm nicht, mit der rechten Hand steckte er sie in den Mund, mit der linken zog er den Zopf an – Krak – zerfiel die Nuß in Stücke! – Marie war glutrot geworden, als sie den jungen artigen Mann erblickte, und noch röter wurde sie, als nach Tische der junge Droßelmeier sie einlud, mit ihm in das Wohnzimmer an den Glasschrank zu gehen. „Spielt nur hübsch miteinander, ihr Kinder, ich habe nun, da alle meine Uhren richtig gehen, nichts dagegen“, rief der Obergerichtsrat. Kaum war aber der junge Droßelmeier mit Marien allein, als er sich auf ein Knie niederließ, und also sprach: „O meine allervortrefflichste Demoiselle Stahlbaum sehn Sie hier zu Ihren Füßen den beglückten Droßelmeier, dem Sie an dieser Stelle das Leben retteten! – Sie sprachen es gütigst aus, daß Sie mich nicht wie die garstige Prinzessin Pirlipat verschmähen wollten, wenn ich Ihretwillen häßlich geworden! – sogleich hörte ich auf ein schnöder Nußknacker zu sein, und erhielt meine vorige nicht unangenehme Gestalt wieder. O vortreffliche Demoiselle, beglücken Sie mich mit Ihrer werten Hand, teilen Sie mit mir Reich und Krone, herrschen Sie mit mir auf Marzipanschloß, denn dort bin ich jetzt König!“ – Marie hob den Jüngling auf, und sprach leise: „Lieber Herr Droßelmeier! Sie sind ein sanftmütiger guter Mensch, und da Sie dazu noch ein anmutiges Land mit sehr hübschen lustigen Leuten regieren, so nehme ich Sie zum Bräutigam an!“ – Hierauf wurde Marie sogleich Droßelmeiers Braut. Nach Jahresfrist hat er sie, wie man sagt, auf einem goldnen von silbernen Pferden gezogenen Wagen abgeholt. Auf der Hochzeit tanzten zweiundzwanzigtausend der glänzendsten mit Perlen und Diamanten geschmückten Figuren, und Marie soll noch zur Stunde Königin eines Landes sein, in dem man überall funkelnde Weihnachtswälder, durchsichtige Marzipanschlösser, kurz, die allerherrlichsten wunderbarsten Dinge erblicken kann, wenn man nur darnach Augen hat. Das war das Märchen vom Nußknacker und Mausekönig. |
Existiert das Puppenreich? Die Perspektivierung des Geschehens durch die verschiedenen Positionen der Figuren lässt Zweifel an der Faktizität des Puppenreichs zu. Ausgehend von Maries Verletzung, muss es aus der Sicht der aufgeklärten Eltern ein Wundfieber sein, dass ihr die phantastischen Halluzinationen beschert. Marie hingegen nimmt diese Vermutung zwar wahr, ist aber dennoch in ihrem Glauben nicht erschüttert, denn sie ist sich gewiss, dass die Schlacht stattfand und ihr Nußknacker unverletzt geblieben ist. Obwohl sie weiterhin von der Belebung des Nußknackers überzeugt ist und sich damit nicht der Meinung ihres Vaters anschließt, scheint ihre Wahrnehmung der wunderbaren Ereignisse oftmals getrübt zu sein; aufgrund ihrer Verankerung in der bürgerlichen Welt, der Konfrontation mit den aufgeklärten Erklärungsmustern und der Uneindeutigkeit des Erzählers an entscheidenden Textstellen bleibt ein Restzweifel bestehen. Der pädagogische Sprachduktus des Erzählers zeichnet sich – weitgehend – durch Neutralität und beinahe konkrete Beschreibungen aus. Besonders im Vergleich zu anderen Märchen und phantastischen Erzählungen Hoffmanns fällt die häufige Verwendung des Indikativs auf; üblicherweise lassen sich interpretatorische Unsicherheiten in Hoffmanns Texten auf den verwendeten Konjunktiv, Verben des Zweifelns und Formeln wie ›es war als ob‹ bzw. anders gesagt: auf den unzuverlässigen Erzähler zurückführen. Auch die steten Leseransprachen an das vermeintlich kindliche Publikum und die Erzählerkommentare scheinen die Faktizität des Wunderbaren zu bezeugen, denn in der Regel verbürgt die Erzählerinstanz die Wahrhaftigkeit des Geschehens. Obgleich also durchaus Zweifel durch die Figuren und den Erzähler gesät werden, lassen sich im Nußknacker (regelrecht untypisch) viele Indizien finden, die die tatsächliche Existenz des Puppenreichs nahelegen. Happy End? Entgegen der üblichen Märchentradition, in der der Held drei Aufgaben erfolgreich absolvieren muss, um sein ›Happy End‹ zu finden, bereitet der dritte Teil kein glückliches Ende vor. Doch genau durch diesen Bruch mit der Märchentradition gelingt es, die Handlung des Binnenmärchens als Vorgeschichte an den Nußknacker anzugliedern. Den glücklichen Ausgang der Geschichte, den die Prinzessin Pirlipat in ihrer Oberflächlichkeit verweigert, kann nun die tugendhafte Marie ihrem Nußknacker bescheren. Dabei sei auf zwei Auffälligkeiten hingewiesen: Die Verzauberung Pirlipats, die am Ende der Neffe Droßelmeier selbst erleidet, spiegelt einerseits hier nicht die Handlung des Nußknackers wider, sondern der Nußknacker wiederholt – versteht man das Märchen von der harten Nuß als Vorgeschichte – die Handlung des Binnenmärchens. Das dynamische Wechselverhältnis zwischen extra- und intradiegetischer Ebene in Nußknacker und Mausekönig erhält dadurch eine zyklische Struktur – und legitimiert somit die Frage, ob das Märchen ›kindgemäß‹ ist. Andererseits erscheinen die Titel der Kapitel besonders auffällig. Während die Überschriften der Kapitel auf der extradiegetischen Ebene auf den Inhalt verweisen, pointieren die Peritexte des Binnenmärchens die innerhalb der Nußknacker-Handlung beschriebene Erzählsituation: Das Märchen, seine Fortsetzung und sein Beschluß. Auch hier lassen sich strukturelle Parallelen zwischen Märchen und Binnenmärchen erkennen: Auch die Handlung um die Protagonistin Marie wird erzählt, vom Binnenmärchen unterbrochen, fortgesetzt und beendet. Figurenkonstellationen zwischen den Welten Die
gesamte Handlung des Nußknackers wird durch den personalen Erzähler aus der
kindlichen Perspektive der siebenjährigen Marie geschildert und durch
verschiedene Erklärungsmodelle anderer Figuren konterkariert. Dabei
lässt sich anhand des Figurentableaus nachvollziehen, inwiefern eine (durch
die Eltern und Luise repräsentierten) aufgeklärt-bürgerliche Welt einem
wunderbaren Reich gegenübergestellt wird. Die beiden Kinder Fritz und Marie
sind, ganz in Hoffmann’scher Manier, durch ihr kindlich-unschuldiges Gemüt
in der Lage, die Wunderdinge in der Welt erkennen zu können. Der mysteriös
und kauzig erscheinende Pate Droßelmeier und sein Neffe scheinen zwischen
diesen beiden ›Lagern‹ zu stehen, da sie als Doppelidentitäten beiden Welten
anzugehören scheinen. Diese Grundbedingung, nämlich der Umstand, dass sich
zwei Welten gegenüber stehen und einige Figuren beiden angehören, erzeugt
erneut eine textimmanente Ambivalenz und somit die Möglichkeit
der Oszillation zwischen Wunderbarem und Rationalem – nicht zuletzt auch
deshalb, da sich die divergenten Standpunkte innerhalb einer als Einheit zu
begreifenden Familie unvereinbar gegenüberstehen. toller Schnack: niederdeutsch für gemütliche Plauderei, Unterhaltung
Vignette, gezeichnet von von E. T. A. Hoffmann In der Schlußvignette, die
Hoffmann für den Erstdruck des Märchens gezeichnet hat, erkennt man eine
weibliche Figur, die zwei Kronen zu verteilen hat; die eine Krone kommt dem
anmutigen Mädchen auf der linken Seite zu, das in einer tänzerischen
Bewegung gezeigt wird, die andere dem Jungen auf der rechten Seite, der
einen militärischen Stechschritt vorführt. Es sind natürlich die beiden
Kinder im Märchen, Marie und Fritz. Sie werden, als befanden sie sich auf
Wagschalen, als vollkommen gleichberechtigt dargestellt, so daß man in der
weiblichen Figur, die ihnen die Kronen zukommen läßt, die Allegorie einer
Poesie sehen kann, die beiden Themen, der ungebundenen Phantasie und der
Wirklichkeit des Krieges, Gerechtigkeit widerfahren lassen will. Die Erzählung erfolgt aus zwei konträren Perspektiven: Aus der ersten – märchenhaften – Perspektive gesehen, handelt der Text davon, wie sich, beginnend an einem Weihnachtsabend, die wundersame Erlösung eines jungen Mannes aus einer mechanischen Holzpuppe vollzieht. Diese Erlösung wird vollbracht durch das Mädchen Marie. Sie bewirkt sie kraft ihrer Liebe und ihrer Phantasie, beide werden genährt durch die Poesie eines Märchens, das Maries Pate erzählt. In diesem Binnenmärchen mit dem Titel „Das Märchen von der harten Nuß“ wird der Nussknacker als Herrscher des Puppenreiches präsentiert. Auch die Rahmenhandlung endet im Puppenreich, in das der nunmehr aus seiner Nussknacker-Gestalt erlöste König mit Marie reist und wo ihrer beider Hochzeit gefeiert wird. Aus der
zweiten – novellistischen – Perspektive betrachtet, besteht die Handlung
darin, dass die kindliche Protagonistin in zunehmendem Maße die Fähigkeit
verliert, zwischen Traum und Wachleben zu unterscheiden, damit in Konflikte
mit ihrer Familie gerät und sich mehr und mehr in ihr Inneres zurückzieht.
Wie die Geschichte von diesem Blickpunkt aus betrachtet endet, bleibt offen.
Die Deutungsmöglichkeit, dass die Heldin dauerhaft geistig er- Peggy Fiebich: „[I]n einem Strich fort, aus dem Walde mitten in Asien nach Nürnberg“–Querdenken mit E. T. A. Hoffmanns „Nussknacker und Mausekönig“. In Querdenken. https://brill.com/display/book/9783657783809/B9783657783809-s007.xml (16.-3.2025)
Gekoppelt sind die Uneindeutigkeiten der
Erzählung wie auch die phantastischen Erlebnisse Maries neben dem
Nussknacker auch an die Figur des Paten Droßelmeier, der in verschiedenen
Rollen und Repräsentationen auf allen Erzählebenen erscheint. Er schenkt
Marie den Nussknacker zu Weihnachten, als Erzähler des »Märchens von der
harten Nuss« initiiert er zudem den Mythos um die (Zurück-)Verwandlung des
Nussknackers in einen Menschen und setzt Maries Imaginationsprozess in Gang.
Einige Elemente von Droßelmeiers Binnenmärchen lassen sich versatzstückartig
immer wieder auf den verschiedenen Erzählebenen finden, die sich nicht mehr
eindeutig voneinander trennen lassen. Unklar bleibt bis zum Schluss, ob das
phantastische Puppenreich eine existente Parallelwelt darstellt, die nur
Marie zugänglich ist, oder ob es sich um eine von Maries exzessiver
Imaginationskraft erzeugte wahnhafte Sphäre handelt. So lässt sich der
Schluss des Nussknackers, der auf den ersten Blick ein für ein Märchen
typisches Happy End präsentiert, auch anders lesen. Maries Hochzeit und
anschließende Krönung zur Königin des »wunderbaren Feenreichs« mit »süßwogendem
Rauschen« und »holden lieblichen Klängen« suggeriert eine unrealistische
Anlage des Geschehens. Das Puppenreich, bestehend aus jeder »Menge
herrlicher Spielsachen«, dem »schönsten Marzipan« sowie »farbig funkelnden
Kristallen« und hübschen »Prinzessinnen«, erinnert vielmehr an eine
kindlich-utopische Vorstellung eines paradiesischen Schlaraffenlandes. Der
Schluss der Erzählung lässt auf Maries noch sehr kindliche Phantasie
schließen, wenn sie »auf einem goldnen von silbernen Pferden gezogenen
Wagen« Einzug in das wundersame Land voller »Marzipanschlösser« und
funkelnder »Weihnachtswälder« hält. Auch die hierarchische Struktur des
Puppenreichs zeugt von einem kindlichen Verständnis der geschlechtlichen und
gesellschaftlichen Ordnung, was nicht verwunderlich erscheint, ist Marie zum
Zeitpunkt der Hochzeit doch gerade einmal acht Jahre alt. Der Text erscheint
unter dieser Perspektive nicht als erfolgreiche Sozialisations- und
Initiationsgeschichte, die mit Maries Eingliederung in die bürgerliche
Gesellschaft endet, sondern vielmehr als Regression in die
kindlich-imaginative Sphäre des Feenreichs, die den Nussknacker als
Symbolfigur kindlicher Phantasie darstellt. Der vorletzte Satz des Textes
ruft diese Lesart erneut auf: »Marie soll noch zur Stunde Königin eines
Landes sein, in dem man überall funkelnde Weihnachtswälder, durchsichtige
Marzipanschlösser, kurz, die allerherrlichsten wunderbarsten Dinge erblicken
kann, wenn man nur darnach Augen hat«. Die erzählerische Distanzierung –
Marie »soll« noch Königin des Puppenreichs sein – ruft Verunsicherungen für
das Ende des Märchens auf und eröffnet Möglichkeitsräume für eine andere
Lesart. In Verknüpfung mit dem Verweis auf die Augen, die für den
Realitätsgehalt dieser Szenerie entsprechend vorhanden sein müssen, ist auch
wieder auf den imaginativen Blick verwiesen: Nicht nur produziert erst
Maries imaginativer und projektiver Blick die Verlebendigung des
Nussknackers, auch das wunderbare Feenreich ist nur unter einem solchen
Blick vorhanden. Maries Einzug in das phantastische Puppenreich ist demnach
gleichzeitig eine Hinwendung zu den ›inneren Bildern‹, die keine
Entsprechung mehr im Außen finden. Das von Marie imaginierte Feenreich lässt
sich so auch als eskapistisch imaginierter Raum fassen, der Marie nicht nur
in dieser phantastischen Sphäre verortet, sondern gleichzeitig die
Künstlichkeit der Märchenform ausstellt. Hoffmanns Kindermärchen erzählt von
facettenreichen phantastischen Dingen, die sich von den Schilderungen der
ungeahnten schöpferischen Fähigkeiten der jungen Marie bis hin zum Ende des
Textes als weitaus komplexer und wunderbarer erweisen, als es in den meisten
Märchen der Fall ist.
Isa Schikorsky: Im Labyrinth der Phantasie: Ernst Theodor Amadeus Hoffmanns Wirklichkeitsmärchen „Nußknacker und Mausekönig“, S. 535f.. |
|
„Sage mir“, sprach Theodor, „sage mir, lieber Lothar, wie du nur deinen Nußknacker und Mausekönig ein Kindermärchen nennen magst, da es ganz unmöglich ist, daß Kinder die feinen Fäden die sich durch das Ganze ziehen, und in seinen scheinbar völlig heterogenen Teilen zusammenhalten, erkennen können. Sie werden sich höchstens am einzelnen halten, und sich hin und wieder daran ergötzen.“ „Und ist dies nicht genug?“ erwiderte Lothar. „Es ist“, fuhr er fort, „überhaupt meines Bedünkens ein großer Irrtum, wenn man glaubt daß lebhafte fantasiereiche Kinder, von denen hier nur die Rede sein kann, sich mit inhaltsleeren Faseleien, wie sie oft unter dem Namen Märchen vorkommen, begnügen. Ei – sie verlangen wohl was Besseres und es ist zum Erstaunen, wie richtig, wie lebendig sie manches im Geiste auffassen, das manchem grundgescheuten Papa gänzlich entgeht. Erfahrt es und habt Respekt! – Ich las mein Märchen schon Leuten vor die ich allein für meine kompetenten Kunstrichter anerkennen kann, nämlich den Kindern meiner Schwester. Fritz, ein großer Militär, war entzückt über die Armee seines Namensvetters, die Schlacht riß ihn ganz hin – Er machte mir das Prr und Puff und Schnetterdeng und Bum Burum mit gellender Stimme nach, rutschte unruhig auf dem Stuhle hin und her, ja! – blickte nach seinem Säbel hin, als wolle er dem armen Nußknacker zu Hülfe eilen, da dessen Gefahr immer höher und höher stieg. Weder die neueren Kriegsberichte noch den Shakespeare hat aber Neffe Fritz zur Zeit gelesen, wie ich euch versichern kann, was es mit den militärischen Evolutionen jener entsetzlichsten aller Schlachten, so wie, was es mit dem: ›Ein Pferd – ein Pferd – ein Königreich für ein Pferd –‹ für eine Bewandtnis hat, ist ihm daher gewiß ganz und gar entgangen. Ebenso begriff meine liebe Eugenie von Haus aus in ihrem zarten Gemüt Mariens süße Zuneigung zum kleinen Nußknacker, wurde bis zu Tränen gerührt, als Marie Zuckerwerk – Bilderbücher ja ihr Weihnachtskleidchen opfert, nur um ihren Liebling zu retten, zweifelte nicht einen Augenblick an die schöne herrlich funkelnde Kandis-Wiese, auf die Marie aus dem Kragen des verhängnisvollen Fuchspelzes in ihres Vaters Kleiderschrank hinaussteigt. Das Puppenreich machte die Kinder überglücklich.“ „Dieser Teil deines Märchens“, nahm Ottmar das Wort, „ist, behält man die Kinder als Leser oder Zuhörer im Auge, auch unbedenklich der gelungenste. Die Einschaltung des Märchens von der harten Nuß, unerachtet wieder darin die Bindungsmittel des Ganzen liegen, halte ich deshalb für fehlerhaft, weil die Sache wenigstens scheinbar sich dadurch verwirrt und die Fäden sich auch zu sehr dehnen und ausbreiten. Du hast uns nun zwar für inkompetente Richter erklärt und dadurch Schweigen geboten, verhehlen kann ich's dir aber nicht, daß, solltest du dein Werk ins große Publikum schicken, viele sehr vernünftige Leute, vorzüglich solche die niemals Kinder gewesen, welches sich bei manchen ereignet, mit Achselzucken und Kopfschütteln zu erkennen geben werden, daß alles tolles, buntscheckiges, aberwitziges Zeug sei, oder wenigstens, daß dir ein tüchtiges Fieber zu Hülfe gekommen sein müsse, da ein gesunder Mensch solch Unding nicht schaffen könne.“ „Da würd ich“, rief Lothar lachend, „da würd ich mein Haupt beugen vor dem vornehmen Kopfschüttler, meine Hand auf die Brust legen und wehmütig versichern, daß es dem armen Autor gar wenig helfe, wenn ihm wie im wirren Traum allerlei Fantastisches aufgehe, sondern daß dergleichen, ohne daß es der ordnende richtende Verstand wohl erwäge, durcharbeite und den Faden zierlich und fest daraus erst spinne, ganz und gar nicht zu brauchen. Zu keinem Werk würd ich ferner sagen, gehöre mehr ein klares ruhiges Gemüt, als zu einem solchen, das wie in regelloser spielender Willkür von allen Seiten ins Blaue hinausblitzend, doch einen festen Kern in sich tragen solle und müsse.“ „Wer“, sprach Cyprian, „wer vermag dir darin zu widersprechen. Doch bleibt es ein gewagtes Unternehmen das durchaus Fantastische ins gewöhnliche Leben hineinzuspielen und ernsthaften Leuten, Obergerichtsräten, Archivarien und Studenten tolle Zauberkappen überzuwerfen, daß sie wie fabelhafte Spukgeister am hellen lichten Tage durch die lebhaftesten Straßen der bekanntesten Städte schleichen und man irre werden kann an jedem ehrlichen Nachbar. Wahr ist es, daß sich daraus ein gewisser ironisierender Ton von selbst bildet, der den trägen Geist stachelt oder ihn vielmehr ganz unvermerkt mit gutmütiger Miene wie ein böser Schalk hineinverlockt in das fremde Gebiet.“ „Dieser ironische Ton“, sprach Theodor, „möchte die gefährlichste Klippe sein, da an ihr sehr leicht die Anmut der Erfindung und Darstellung welche wir von jedem Märchen verlangen scheitern, rettungslos zugrunde gehen kann.“ „Ist es denn möglich“, nahm Lothar das Wort, „die Bedingnisse solcher Dichtungen festzustellen? – Tieck, der herrliche tiefe Meister, der Schöpfer der anmutigsten Märchen, die es geben mag, hat darüber den Personen die im Phantasus auftreten auch nur einzelne geistreiche und belehrende Bemerkungen in den Mund gelegt. Nach diesen soll Bedingnis des Märchens ein still fortschreitender Ton der Erzählung, eine gewisse Unschuld der Darstellung sein, die wie sanft fantasierende Musik ohne Lärm und Geräusch die Seele fesselt. Das Werk der Fantasie soll keinen bittern Nachgeschmack zurücklassen, aber doch ein Nachgenießen, ein Nachtönen. – Doch reicht dies wohl aus, den einzig richtigen Ton dieser Dichtungsart anzugeben? – An meinen Nußknacker will ich nun gar nicht mehr denken, da ich selbst eingestehen daß ein gewisser unverzeihlicher Übermut darin herrscht, und ich zu sehr an die erwachsenen Leute und ihre Taten gedacht; aber bemerken muß ich, daß das Märchen unsers entfernten Freundes, der goldene Topf benannt, auf das du, Cyprian vorhin anspieltest, vielleicht etwas mehr von dem, was der Meister verlangt, in sich trägt und eben deshalb viel Gnade gefunden hat vor den Stühlen der Kunstrichter. – Übrigens habe ich den kleinen Kunstrichtern in meiner Schwester Kinderstube versprechen müssen, ihnen zum künftigen Weihnachten ein neues Märchen einzubescheren, und ich gelobe euch, weniger in fantastischem Übermut zu luxurieren, frömmer, kindlicher zu sein. – Für heute seid zufrieden, daß ich euch aus der entsetzlichen schauervollen Dinge zu Falun ans Tageslicht gefördert habe und daß ihr so fröhlich und guter Dinge geworden seid, wie es den Serapions-Brüdern ziemt, vorzüglich im Augenblick des Scheidens. Denn eben hör ich die Mitternachtsstunde schlagen.“ „Serapion“, rief Theodor indem er aufstand und das vollgeschenkte Glas hoch erhob, „Serapion möge uns fernerhin beistehen und uns erkräftigen, das wacker zu erzählen, was wir mit dem Auge unsers Geistes erschaut!“ „Mit dieser Anrufung unseres Heiligen scheiden wir auch heute als würdige Serapions-Brüder!“ So sprach Cyprian und alle ließen noch einmal die Gläser erklingen, sich der Innigkeit und Gemütlichkeit, die ihren schönen Bund immer fester und fester verknüpfte, recht aus dem tiefsten Herzen heraus erfreuend. |
Archivarien und
Studenten: Anspielung auf das Märchen Der goldene Topf von E. T. A.
Hoffmann, das 1814 erstmals erschien und 1819 vom Autor überarbeitet wurde.
Es gilt als das erfolgreichste Werk Hoffmanns. Der Autor hat dem Werk die
Gattungsbezeichnung Märchen aus der neuen Zeit gegeben. Es ist in zwölf
„Vigilien“ eingeteilt.
Claudia Liebrand: Die Serapionsbrüder - E.T.A. Hoffmann Portal Entstehung Auf Anregung des Verlegers Georg Andreas Reimer beschäftigte sich E.T.A. Hoffmann seit Anfang 1818 mit dem Vorhaben, eine Erzählsammlung herauszubringen. Reimer, der Inhaber der Realschulbuchhandlung in Berlin, hatte zuvor bereits die Hoffmann’schen Nachtstücke publiziert sowie die zweibändigen Kinder-Mährchen verlegt (als Beiträger fungierten neben Hoffmann Karl Wilhelm Salice-Contessa und Friedrich de la Motte Fouqué). Bereits im ersten Brief, den Hoffmann seinem Verleger in Bezug auf das Projekt schrieb, erörterte der Autor die zu wählende Präsentationsform der Sammlung: „Erlauben Sie indessen eine Frage deren Entscheidung ich Ihnen gänzlich überlasse so wie Sie glauben, daß das Buch besser geht. Ist es gerathener die Sachen unter dem simplen Titel: Erzählungen gehn zu lassen oder eine Einkleidung zu wählen nach Art des Tiekschen Phantasus?“[1] Bekanntlich entschied sich Hoffmann für eine Publikation in der Phantasus-Nachfolge. War zunächst nur ein Erzählungen-Band vorgesehen, wuchs sich das Projekt schließlich auf vier Bände aus (erschienen zwischen 1819 und 1821). Der erste Band (Februar 1819) enthält acht Erzählungen – darunter: Der Einsiedler Serapion, Rat Krespel, Die Fermate, Der Artushof, Die Bergwerke zu Falun, Nußknacker und Mausekönig. Der zweite Band (September 1819) versammelt sieben Erzählungen – darunter: Die Automate, Doge und Dogaresse, Meister Martin der Küfner und seine Gesellen, Das fremde Kind. Unter den sechs Erzählungen des dritten Bandes (September 1820) findet sich Das Fräulein von Scuderi. Der vierte und letzte Band, erschienen im Mai 1821, umfasst wieder sieben Texte. Abgeschlossen wird die Sammlung vom Märchen Die Königsbraut. Nur sechs der Erzählungen, die in den Serapions-Brüdern abgedruckt sind, wurden für diese Sammlung geschrieben: Der Einsiedler Serapion, Die Bergwerke zu Falun, Zacharias Werner, Vampyrismus, Die ästhetische Teegesellschaft, Die Königsbraut. Versuchte Reimer Hoffmann dazu zu animieren, neue Erzählungen für die Serapions-Brüder zu schreiben (um die Attraktivität des Projekts für die Leser zu erhöhen), war es Hoffmann auch um die ökonomisch attraktive und marktstrategisch kluge Zweitverwertung seiner Texte, die zuvor in Journalen und Taschenbüchern publiziert worden waren, zu tun. Anders aber als bei anderen Erzählungssammlungen des Autors (etwa den Nachtstücken) wurden die in die Serapions-Brüder aufgenommenen Erzählungen gründlich redigiert. Ohnehin erscheinen sie durch die Rahmengespräche, in die sie gestellt werden, in neuem Licht. Konzipiert hat Hoffmann seinen Zyklus im Rekurs auf die eigene Praxis romantischer Geselligkeit und ,Sympoesie‘, war er doch Mitbegründer sowohl des Seraphinenordens (12. Oktober 1814) als auch des Bundes der Serapions-Brüder (14. November 1818).[2]
Literaturhistorische Traditionslinien Mit der Entscheidung, „eine Einkleidung zu wählen nach Art des Tiekschen Phantasus“,[3] entwarf Hoffmann die Serapions-Brüder als Parallel- respektive Konkurrenzprodukt zu Tiecks Phantasus, der nicht vierbändig, sondern dreibändig angelegten Sammlung von Märchen, Schauspielen und Novellen, die 1812 (Bd. 1 und Bd. 2) und 1816 (Bd. 3) erschienen war – im Verlag just jenes Georg Reimers, der auch Hoffmanns Serapions-Brüderanregte. Nun verweist das Serapions-Brüder-Projekt aber nicht nur auf Novellensammlungen der Zeit, sondern verhandelt die – lange – Geschichte der alteuropäischen Novellistik, die mit Boccaccios Il Decamerone, geschrieben Mitte des 14. Jahrhunderts in Florenz, mit einem Paukenschlag beginnt. Zur Zeit als in Florenz die Pest wütet – so die Rahmenhandlung des Decamerone – verlässt eine Gruppe von zehn Florentinern die Stadt. Auf einem Landgut widmen sich die jungen Leute einem Vergnügungs- und Zerstreuungsprogramm: Sie tanzen, sie singen, sie delektieren sich an exquisiten Speisen, und sie erzählen sich (der Titel Decamerone, der aus dem griechischen deka [zehn] und hemera[Tage] zusammengesetzt ist, verweist darauf) an jeweils zehn Tagen zehn Geschichten. Für die einzelnen Tage wird ein – meist thematisch fokussiertes – ‚Erzählprogramm‘ festgelegt, eine der zehn Vorgaben bezieht sich auf Liebesgeschichten mit Happy Ending, eine andere lässt die Erzählerinnen und Erzähler darbieten, was ihnen am meisten zusagt. Alle Geschichten sollen, deshalb werden sie präsentiert, Pest und Tod vergessen lassen. Es handelt sich also um ein Erzählen gegen den Tod; die Erzählerinnen und Erzähler könnten mit zweitem Namen Schehezarade heißen: Sie negieren nicht nur den Tod, der ihre Stadt getroffen hat, sie schieben auch den Tod, der sie selbst bedroht, erzählend auf. Hoffmann greift mit seinen Serapions-Brüdern die Rahmenstruktur der europäischen Novelle auf, nimmt aber Veränderungen vor: Diejenigen, die sich treffen, um sich Novellen zu erzählen, lassen sich nicht mehr als (sich aufs Land zurückziehende) adelige Gesellschaft beschreiben (wie noch in Goethes Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten). Der Anlass des Erzählens ist keine soziale oder politische Katastrophe mehr (wie die Pest bei Boccaccio oder die Französische Revolution bei Goethe): Es trifft sich im großstädtischen Raum, im zeitgenössischen Berlin, ein Kreis von sich in bürgerlichen Kontexten bewegenden Schriftstellern und Intellektuellen, dem es angesichts von zu führenden kulturellen Debatten um sozialpoetische Praktiken geht. Andreas Beck führt aus, dass der Eingangsteil der Serapions-Brüder zeige, daß dem radikalen Ungenügen an der vorgefundenen Wirklichkeit zum Trotz in dieser durchaus ein erfülltes Leben in Gemeinschaft mit Andern vorstellbar ist: im Rahmen eines gegen das Gros der Philister […] abgegrenzten Künstlerzirkels, dessen Mitlieder durch sympoetische, auf dem Gebiet sämtlicher Kunstgattungen spielende Interaktion zueinander finden – in gelingender, wenn auch stets gefährdeter, hart an der Grenze ironischer Desperation operierender Geselligkeit.[4] Ausdrücklich aufgeworfen, darauf verweist auch Christine Lubkoll,[5] wird in Hoffmanns Novellenzyklus die Frage, warum in dieser „Gesellschaft die holden Frauen [fehlen]“[6]. Sind in Boccaccios Novellenzyklus sieben der zehn Erzähler weiblich, gibt es unter den Serapions-Brüdern keine Frauen (obgleich doch viele Frauen in der Salonkultur um 1800 ihre Rolle spielten). Als Publikum der Serapions-Brüder hat sie Hoffmann aber so dezidiert im Blick wie Boccaccio, ist der Decamerone doch ausdrücklich für die donne geschrieben. Boccaccio erörtert das in der Vorrede ausführlich: Er adressiere die Frauen – jene, die es in Liebesdingen und sonst im Leben so viel schwerer als die Männer hätten: Und wer könnte leugnen, daß des Trostes, wie immer es auch um ihn bestellt sein mag, weit mehr als die Männer die holden Frauen bedürfen? Sie verbergen aus Furcht und Scham in ihrem zarten Busen die Flammen der Liebe. Doch mit welcher Gewalt diese sich vor aller Welt zu äußern begehren, das weiß nur, wer es an sich selber erfahren hat und noch erfährt. Darüber müssen die Frauen, abhängig von den Wünschen, Geboten und Befehlen ihrer Väter und Mütter, Brüder und Gatten, die meiste Zeit in den engen Grenzen ihrer geschlossenen Häuslichkeit verbringen, wo sie, fast ohne Beschäftigung, gleichzeitig wollend und nicht wollend, sich ihren Gefühlen hingeben, die gewiß nicht immer die fröhlichsten sind. Wenn dann infolge ihres sehnsüchtigen Verlangens Schwermut ihre Herzen überfällt, müssen sie diese in Trübsal erdulden, bis endlich andere Gedanken diese wieder verjagen; ganz zu schweigen davon, daß die Frauen viel weniger ertragen als Männer […].[7]
Boccaccio etabliert die Novelle mithin als ‚weibliche‘ Gattung.[8] Sie
erzählt im ‚niederen Stil‘ (istilo umilissimo) auch von den Geschicken der
Frauen, interessiert sich für die – kasuistisch abzuhandelnden –
Verwicklungen des Privaten, ist konzipiert für Leserinnen. Bei den abendlichen Treffen wird Punsch getrunken, nach dem Verlesen werden die vorgetragenen Texte in den literaturkritischen Blick genommen, intensive Gespräche über das Gehörte werden geführt: Wie literarisch oder wissenschaftlich interessant ist das präsentierte Sujet? Wie lässt sich die poetische Faktur des Textes beschreiben? Genügt das Präsentierte den ästhetischen Anforderungen der Gruppierung? Der Novellenzyklus führt mithin eine als genuin romantisch zu klassifizierende Zusammenführung von Literatur und Kritik vor, aber auch von Literatur und Wissenschaft.
Das serapiontische Prinzip Wiederholt ist auf den über 1000 Seiten des Novellenzyklus vom serapiontischen Prinzip, dem sich die Serapions-Brüder verpflichtet fühlen (und das ihnen als Messlatte gilt, ob ein Text als ästhetisch gelungen zu werten ist), die Rede. Uwe Japp hat mit Recht darauf hingewiesen, dass dieses Prinzip „an den verschiedensten Stellen vor[komme], allerdings mit durchaus wechselnden Begründungen. Es ist deshalb in der Forschung auch die Auffassung vertreten worden, dass es sich überhaupt nicht um ein auch nur einigermaßen konsistentes Theorem handelt“.[10] Präzisiert wird das serapiontische Prinzip nicht direkt im Anschluss an die Erzählung Cyprians vom Einsiedler Serapion (eines wahnsinnig gewordenen Grafen, der sich für den Heiligen Serapion der Antike hält), sondern erst nach der Erzählung von Rat Krespel von Lothar: Jeder prüfe wohl, ob er auch wirklich das geschaut, was er zu verkünden unternommen, ehe er es wagt laut damit zu werden. Wenigstens strebe jeder recht ernstlich darnach, das Bild, das ihm im Innern aufgegangen recht zu erfassen mit allen seinen Gestalten, Farben, Lichtern und Schatten, und dann, wenn er sich recht entzündet davon fühlt, die Darstellung ins äußere Leben tragen. So muß unser Verein auf tüchtige Grundpfeiler gestützt dauern und für jeden von uns allen sich gar erquicklich gestalten. Der Einsiedler Serapion sei unser Schutzpatron, er lasse seine Sehergabe über uns walten, seiner Regel wollen wir folgen, als getreue Serapions-Brüder![11] Von der Forschung immer wieder herausgearbeitet wurde, dass die ‚innere Schau‘, auf die hier verwiesen ist – gehe es doch um die Abgrenzung des Dichters vom Wahnsinnigen –, nicht abgelöst gesehen werden dürfe von der für Hoffmann wichtigen Erkenntnis der Duplizität. Mit Duplizität sei auf die Spannung von äußerer Wirklichkeit und innerem Bild verwiesen, die nicht suspendiert werden könne.[12] |
Anmerkungen
[1] Segebrecht, Wulf: Kommentar zu Die Serapions-Brüder. In: Deutscher Klassiker Verlag im Taschenbuch. Bd. 28: E.T.A. Hoffmann: Die Serapions-Brüder. Gesammelte Erzählungen und Märchen. Hg. von Wulf Segebrecht. Frankfurt a.M. 2008, S. 1201–1655, hier S. 1229.
[2] Vgl. Steinecke, Hartmut: Die Kunst der Fantasie. E.T.A. Hoffmanns Leben und Werk. Frankfurt a.M., Leipzig 2004, S. 353f.
[3] Segebrecht, Wulf: Kommentar zu Die Serapions-Brüder. In: Deutscher Klassiker Verlag im Taschenbuch. Bd. 28: E.T.A. Hoffmann: Die Serapions-Brüder. Gesammelte Erzählungen und Märchen. Hg. von Wulf Segebrecht. Frankfurt a.M. 2008, S. 1201–1655, hier S. 1229.
[4] Beck, Andreas: Geselliges Erzählen in Rahmenzyklen. Goethe – Tieck – E.T.A. Hoffmann. Heidelberg 2008, S. 582.
[5] Vgl. Lubkoll, Christine: Die Serapions-Brüder. Gesammelte Erzählungen und Märchen (1819–21). In: dies. und Harald Neumeyer (Hg.): E.T.A. Hoffmann Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart 2015, S. 77.
[6] Hoffmann, E.T.A.: Die Serapions-Brüder. Gesammelte Erzählungen und Märchen. In: Deutscher Klassiker Verlag im Taschenbuch. Bd. 28: Die Serapions-Brüder. Hg. von Wulf Segebrecht. Frankfurt a.M. 2008, S. 9–1199, hier S. 11.
[7] Boccaccio, Giovanni: Das Dekameron. 2 Bände. Übersetzt von Ruth Macchi. Berlin 1999, S. 8f.
[8] Vgl. Schlaffer, Hannelore: Die Poetik der Novelle. Stuttgart, Weimar 1993, S. 30.
[9] Japp, Uwe: Die Serapions-Brüder (1819/21). In: Detlef Kremer (Hg.): E.T.A. Hoffmann. Leben – Werk – Wirkung. 2., erweiterte Auflage. Berlin, New York 2010, S. 262.
[10] Ebd., S. 263f.
[11] Hoffmann, E.T.A.: Die Serapions-Brüder. Gesammelte Erzählungen und Märchen. In: Deutscher Klassiker Verlag im Taschenbuch. Bd. 28: Die Serapions-Brüder. Hg. von Wulf Segebrecht. Frankfurt a.M. 2008, S. 9–1199, hier S. 69.
[12] Vgl. Segebrecht, Wulf: Kommentar zu Die Serapions-Brüder. In: Deutscher Klassiker Verlag im Taschenbuch. Bd. 28: E.T.A. Hoffmann: Die Serapions-Brüder. Gesammelte Erzählungen und Märchen. Hg. von Wulf Segebrecht. Frankfurt a.M. 2008, S. 1201–1655, hier S. 1244–1250.
Literatur
Texte
Kinder-Mährchen. Von E. W. Contessa, Friedrich Baron de la Motte Fouque, und E. T. A. Hoffmann. Berlin, 1816. In der Realschulbuchhandlung. Nußknacker und Mausekönig, S. 115-271.
Die Serapions-Brüder. Gesammelte Erzählungen und Märchen. Herausgegeben von E. T. A. Hoffmann. Erster Band. Berlin 1819. Bei G. Reimer. Nußknacker und Mausekönig, S. 466-604.
Nußknacker und Mäusekönig. Ein allerliebstes Kindermährchen nach E. T. A. Hoffmann. Oder Neueste Bilderlust in X feinen illuminirten Kupfertafeln nach Original-Zeichnungen von P. C. Geißler. Nürnberg: Verlag der C. H. Zeh’schen Buchhandlung. O. J. (1840)
(anonym) Die Vision auf dem Schlachtfelde bei Dresden. Vom Verfasser der Fantasiestücke in Callots Manier. 16 S. [Bamberg: Kunz] 1814.
Quellen
Der Weihnachtsabend in der Familie Thalberg. für Kinder beschrieben von J.A.C. Löhr. Mit 15 Kupfern. Leipzig, bey Gerhard Fleischer dem jüngern. (1805)
Joachim Heinrich Campe: Väterlicher Rath für meine Tochter. Ein Gegenstück zum Theophron. Der erwachsenen weiblichen Jugend gewidmet. Braunschweig. Im Verlag der Schulbuchhandlung 1791.
Neuer Orbis Pictus in sechs Sprachen oder unterhaltendes und belehrendes Bilderbuch für Kinder in jedem Alter herausgegeben von H. Seidel. Nürnberg und Leipzig 1806.
Forschungsliteratur
Beardsley, Christa-Maria: E. T. A. Hoffmann: Die Gestalt des Meisters in seinen Märchen. Bonn 1975.
Barth, Johannes: „So etwas kann denn doch wohl der Onkel niemals zu Stande bringen“. Ästhetische Selbstreflexion in E. T. A. Hoffmanns Kindermärchen Nußknacker und Mausekönig. In: E. T. A. Hoffmann-Jahrbuch. Bd. 3. 1995, S. 7-14.
Bergström, Stefan: Between Real und Unreal. A thematic study of E.T.A. Hoffmann’s „Die Serapionsbrüder“. New York 2000.
David Blamires: E. T. A. Hoffmann’s Nutcracker and Mouse King. In: Telling Tales. The Impact of Germany on English Children’s Books 1780-1918. Online: Open Book Publishers
Olga Buchtíková: Suche nach den „feinen Fäden, die sich durch das Ganze ziehen“. Eine textorientierte Analyse von E. T. A. Hoffmanns Märchen Nußknacker und Mausekönig. Bachelorarbeit, Brno (Brünn) 2015. https://is.muni.cz/th/ew5h5/Text_diplomove_prace.pdf
Boy, Alina: Marie im Wunderland. Animation und Imagination in Hoffmanns „Nußknacker und Mausekönig“. In: E. T. A.-Hoffmann-Jahrbuch 24 (2016), S. 34-48.
Doms, Misia Sophia/Klingel, Peter: „Was ist der Mensch und was kann aus ihm werden?“. Zur Kritik an rationalistischen Utopien und Erziehungskonzepten in E. T. A. Hoffmanns „Nußknacker und Mausekönig“. Würzburg 2019.
Elardo, R. J.: E.T.A. Hoffmanns „ Nußknacker und Mausekönig”: The Mousequeen in the Tragedy of the Hero. In: Germanic Review 55, 1980, S. 1-8.
Harnischfeger, Johannes: Die Hieroglyphen der inneren Welt. Romantikkritik bei E. T. A. Hoffmann. Opladen 1988.
Heintz, Günther: Mechanik und Phantasie. Zu E. T. A. Hoffmanns Märchen „Nußknacker und Mausekönig“, In: Literatur in Wissenschaft und Unterricht 7, 1974, S. 1-5.
Heimes, Alexandra: Nußknacker und Mausekönig. In: Kremer, Detlef [Hrsg.]: E. T. A. Hoffmann. Leben – Werk – Wirkung. Berlin/New York 2010, S. 287-297.
Hoffmann, E. T. A.: Nussknacker und Mausekönig. In: Ders.: Die Serapions-Brüder. Herausgegeben von Wulf Segebrecht unter Mitarbeit von Ursula Segebrecht. Frankfurt am Main 2008.
Japp, Uwe: Die Serapions-Brüder (1819/21). In: Kremer, Detlef [Hrsg.]: E. T. A. Hoffmann. Leben – Werk – Wirkung. Berlin/New York 2010, S. 257-267.
Junges, Stefanie: Oszillation als Strategie romantischer Literatur. Ein Experiment in drey Theilen. Paderborn 2020.
Junges, Stefanie: ›Kinder-Märchen‹ in a nutshell? E. T. A. Hoffmanns Nußknacker und Mausekönig. https://etahoffmann.staatsbibliothek-berlin.de/portfolio-item/nussknacker-und-mausekoenig/
Klotz, Volker: Das europäische Kunstmärchen. Fünfundzwanzig Kapitel seiner Geschichte von der Renaissance bis zur Moderne. München 2002.
Kremer, Detlef [Hrsg.]: E.T.A. Hoffmann. Leben – Werk – Wirkung. 2., erweiterte Auflage. Berlin/New York 2012.
Küchler-Sakellariou, Petra: Romantisches Kunstmärchen. Versuchen einer Annäherung. Über die Spielarten des Wunderbaren in „Kunst“- und „Volks“märchen. In: Schuhmacher, Hans [Hrsg.]: Phantasie und Phantastik. Neuere Studien zum Kunstmärchen und zur phantastischen Erzählung. Frankfurt am Main 1993, S. 43-74.
Kümmerling-Meibauer, Bettina: Hoffmann, E. T. A.: Nußknacker und Mausekönig. In: KinderundJugendmedien.de. Erstveröffentlichung: 01.03.2013. (Zuletzt aktualisiert am: 18.03.2022). URL: https://www.kinderundjugendmedien.de/werke/587-hoffmann-eta-nussknacker-und-mausekoenig.
Le Berre, Aline: Hoffmanns „Nußknacker und Mausekönig“, eine Parodie auf das Kindermärchen. In: Agard, Oliver/Helmreich, Christian/Vinckel, Hélène [Hrsg.]: Das Populäre. Untersuchungen zu Interaktionen und Differenzierungsstrategien in Literatur, Kultur und Sprache. Göttingen 2011, S. 93-107.
von Müller, Hans: Nachwort zu den
Märchen der Serapions-Brüder von E. T. A. Hoffmann: Nussknacker und Mausekönig.
Das fremde Kind. Die Königsbraut ; nebst
einem kurzen Bericht über die Arbeiten des Herausgebers im verflossenen
Jahr. Berlin 1906.
Neumann, Gerhard: Puppe und Automate. Inszenierte Kindheit in E.T.A. Hoffmanns Sozialisationsmärchen 'Nußknacker und Mausekönig'. In: Oesterle, Günter (Hg.): Jugend - Ein romantisches Konzept?, Würzburg 1997, S. 135-160.
Orosz, Magdolna: Identität, Differenz, Ambivalenz. Erzählstrukturen und Erzählstrategien bei E.T.A. Hoffmann. Frankfurt am Main 2001.
Paksy, Tünde: Ein Spiel mit und über Grenzen? Über E.T.A. Hoffmanns „Nussknacker und Mausekönig“. In: Interdisziplinarität in der Germanistik. Annäherungen in der Literatur-, Sprach- und Kulturwissenschaft. Beiträge der II. Germanistischen Konferenz. Miskolc 2010. https://epa.oszk.hu/02100/02137/00021/pdf/EPA02137_ISSN_1219-543X_tomus_15_fas_3_2010_ger_429-446.pdf
Pietzcker, Carl: Nussknacker und Mausekönig. Gründungstext der Phantastischen Kinder- und Jugendliteratur. In: Saße, Günter [Hrsg.]: E.T.A. Hoffmann. Romane und Erzählungen. Stuttgart 2004.
Pikulik, Lothar: Die Serapions-Brüder. Die Erzählung vom Einsiedler Serapion und das Serapion(t)ische Prinzip – E. T. A. Hoffmanns poetologische Reflexionen. In: Saße, Günter [Hrsg.]: E.T.A. Hoffmann. Romane und Erzählungen. Stuttgart 2004.
Rauch, Marja: E.T.A. Hoffmanns „Nußknacker und Mausekönig“ – ein Kindermärchen? In: Schilcher, Anikta [Hrsg.]: „Klassiker“ der internationalen Jugendliteratur 2. Baltmannsweiler 2013, S. 157-176.
Schikorsky, Isa: Im Labyrinth der Phantasie: Ernst Theodor Amadeus Hoffmanns Wirklichkeitsmärchen „Nußknacker und Mausekönig“. In: Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur. Frankfurt am Main 1995, S. 520-539.
Schildmann, Mareike: Poetik der Seelenmechanik. Kinder, Puppen und Automaten in E.T.A. Hoffmanns „Nußknacker und Mausekönig“. In: Giuriato, Davide/Hubmann, Philipp/Schildmann, Mareike [Hrsg.]: Kindheit und Literatur. Konzepte – Poetik – Wissen. Freiburg i.Br./Berlin/Wien 2018, S. 225-254.
Segebrecht, Wulf: Kommentar zu ›Nußknacker und Mausekönig‹. In: Hoffmann, E. T. A.: Die Serapions-Brüder. Herausgegeben von Wulf Segebrecht unter Mitarbeit von Ursula Segebrecht. Frankfurt am Main 2008, S. 1339-1352.
Segebrecht, Wulf: E. T. A. Hoffmanns Nußknacker und Mausekönig – nicht nur ein Weihnachtsmärchen. In: E. T. A.-Hoffmann-Jahrbuch 17 (2009), S. 62-89.
Vitt-Maucher, Gisela: E. T. A. Hoffmanns Märchenschaffen. Kaleidoskop der Verfremdung in seinen sieben Märchen. Chapel Hill 1989.