Weh dem armen Schlängelein –
„Leila“
In seinem Brief vom 17. März 1840
bedankte sich der Berliner Maler Theodor Wagner für eine Erzählung mit dem Titel
„Leila“: Was aber nun zum zweiten Theile Ihres Briefes sagen? Leila! ‒ Ein
schöner, ja ich möchte sagen ein Feenhafter Name!
Eine Erzählung mit diesem Titel ist von
Storm nicht überliefert; allerdings deuten mehrere Hinweise in Wagners Brief auf
die Novelle „Ein grünes Blatt“
hin, die Storm im Jahre 1854 veröffentlichte. Ich glaube der bloße Name hätte
hingereicht, Ihre in der Märchenwelt so gern verweilende Fantasie in Feuer und
Flamme zu setzen, nun aber ihre Stirn, ihre Augen, und vor allen Dingen ihre
Knöchel! ‒ Das sind freilich Gegenstände die ganz geeignet sind Ihre
Sinnlichkeit (denn gestehen Sie es nur, etwas Sinnlichkeit war dabei) zu wecken.
Es ist in der
Tat eine Märchenwelt, in die uns der Erzähler führt. Ein junger Mann namens
Gabriel verirrt sich im Wald und begegnet einem Mädchen, das Regine heißt; sie
wird folgendermaßen beschrieben:
Er schlug
die Augen auf; und wie er so das junge
Antlitz über dem seinen schweben sah, da sagte er noch halb im Traume:
„Prinzessin, was hast Du für blaue Augen!“
„Dort wohnt
mein Großvater“, sagte sie, „du kannst erst Vesper mit uns essen; nachher weise
ich dir den Weg.“ Als Gabriel das zufrieden war, trat sie von dem schmalen
Fußpfade auf die Heide hinüber und schlug die Richtung nach dem Walde ein. Die
Blicke des jungen Mannes folgten unwillkürlich ihren Füßen, wie sie behend und
sicher über die harten Stauden dahinschritten, während bei jedem Tritt die
Grillen vor ihr aufflogen.
Sie selber
standen noch im Schatten; aber bei der Fülle des Lichtes, die draußen webte,
konnte er ihre ganze Gestalt erkennen und jedes Regen ihrer Gliedmaßen. Sie
hatte im Laufen ihre Flechten aufgebunden, die nun wie ein Kranz auf ihrem
Scheitel lagen. Sie erschien ihm auf einmal so stolz und jungfräulich; er konnte
die Augen nicht von ihr lassen, als sie in den Mondschein hinauswies und ihm die
Wege zeigte, die er gehen sollte.
Die Novelle endet mit einem Gedicht, das
Storm 1856 unter dem Titel „Regine“ veröffentlichte. Im Erstdruck (Gedichte
1852) liest man allerdings die Überschrift „Silvia“.
So hieß das Mädchen offenbar auch in einer Fassung der Novelle, an der Theodor
in den letzten Monaten des Jahres 1850 arbeitete. Die gebundene Handschrift mit
der Notiz „Constanze gewidmet“ schenkte Theodor nach einem Hinweis in seinem
Brief an Laura Setzer
seiner Frau zum Weihnachtsfest.
|
Regine
Und webte auch auf jenen Matten
Noch jene Mondesmärchenpracht,
Und stünd' sie noch im Waldesschatten
Inmitten jener Sommernacht,
Und fänd' ich selber wie im Traume
Den Weg zurück durch Moor und Feld,
Sie schritte doch vom Waldessaume
Niemals hinunter in die Welt.
|
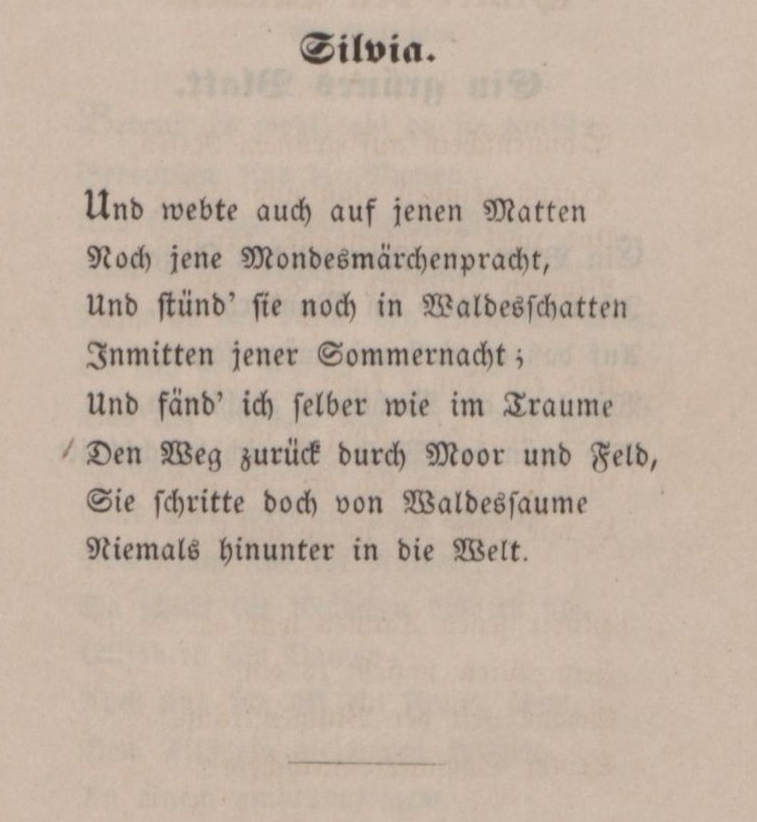 Erstdruck in Storms Gedicht-Ausgabe
1852
Erstdruck in Storms Gedicht-Ausgabe
1852 |
Die Erzählung, die keine Liebesgeschichte
ist,
trug zu diesem Zeitpunkt bereits die Überschrift „Ein grünes Blatt“; eine
Umarbeitung in eine Idylle in Hexametern nahm Storm im März 1853 vor, entschied
sich aber nach kritischen Bemerkungen seines Berliner Freundeskreises für einen
Prosatext. Storm bettete die ursprüngliche Erzählung von einer unerfüllten Liebe
in einen Rahmen ein, der von einem Freischärler während der
schleswig-holsteinischen Erhebung handelt.
Theodor Wagners notierte zu der ihm von
Storm Anfang 1840 zugeschickte Fassung: So sehr ich Sie auch um die schöne
Leila beneide, so wünschte ich doch dass Sie es bei Ihrem singenden Beweis für
Ihre Unwiderstehlichkeit bewenden lassen möchten, und aus dem Gefühl der Liebe
das der Freundschaft zu machen. Meine Gründe dafür brauche ich nicht erst
anzuführen, Sie haben sich beim Schluss Ihrer Liebesgeschichte ganz nach meinen
Grundsätzen genügsam darüber ausgesprochen. Nächstens mehr von Leila.
Mit Ihrem singenden Beweis für Ihre
Unwiderstehlichkeit meint er das Schluss-Gedicht, das Storm in der ersten
Separatausgabe seiner Gedichte mit dem Titel „Silvia“ versah. Außerdem erwähnt
Wagner eine Oelskizze des Mädchens auf dem Berge nach Ihrem Gedichte.
Diese Szenerie lässt sich aus dem Novellentext herleiten. Die abgeschlossene
Welt des Waldes liegt höher als die sie umgebene Wiesen- und Moorlandschaft.
Als sie die feuchten Schatten erreicht hatten, welche
weithin über die Wiesen fielen, konnte Gabriel eine kurze Leiter aus
Fichtenstämmen erkennen, welche zwischen dichten Gebüschen in das höhergelegene
Gehege hinaufführte. Dort „oben“
wird Gabriel von den Bewohnern dieser abgelegenen Idylle empfangen. Als er diese
Wald- und Heidelandschaft wieder verlässt, muss er hinuntersteigen.
Ein Plätschern scholl aus der Ferne; Gabriel lauschte. „Es ist das Fährboot“,
sagte sie, „dort unten liegt die Bucht.“ Bald konnte er deutlich das Geräusch
von Ruderschlägen unterscheiden; dann traten die Bäume plötzlich auseinander und
sie sahen frei ins Land hinaus, das in den sanften Umrissen der Mondbeleuchtung
zu ihren Füßen lag. Als Gabriel zurückblickte, war es ihm, als
stehe die schöne kindliche Gestalt noch immer an der Stelle, wo er von ihr
gegangen, unbeweglich im schwärzesten Tore des Waldes. Dann steigt er
hinunter in die Welt.
Aus diesen Indizien schließe ich, dass
„Leila“ die erste Fassung der späteren Novelle „Ein grünes Blatt“ war, und von
Strom im Winter1840 konzipiert wurde. Der im späteren Erzählrahmen thematisierte
Krieg zwischen den Herzogtümern Schleswig-Holstein und Dänemark fand in den
Jahren 1848 bis 1851 statt. Storm könnte also die später in seine Novelle
eingebettete Begegnung zweier junger Menschen bereits acht Jahre vorher
niedergeschrieben haben und zwar im Zusammenhang mit seiner unglücklichen Liebe
zu Bertha von Buchan.
Die Binnenerzählung liest der
Rahmenerzähler in einem alten Buch:
eine Art Album; aber lang und schmal wie ein Gebetbuch, mit groben gelben
Blättern. Er hatte es während seiner Schülerzeit in einer kleinen Stadt vom
Buchbinder anfertigen lassen, und später überall mit sich herumgeschleppt. Verse
und Lebensannalen wechselten mit einander, wie sie durch äußere oder innere
Veranlassung entstanden waren. In den letzteren pflegte er sich selbst als
dritte Person aufzuführen; vielleicht um bei gewissenhafter Schilderung das Ich
nicht zu verletzen; vielleicht – so schien es mir – weil er das Bedürfnis hatte,
durch seine Phantasie die Lücken des Erlebnisses auszufüllen. Es waren meistens
unbedeutende Geschichten oder eigentlich gar keine; ein Gang durch die
Mondnacht, eine Mittagsstunde in dem Garten seiner Eltern waren oftmals der
ganze Inhalt; in den Versen mußte man über manche Härte und über manchen
falschen Reim hinweg.
Diese Details treffen auf Storm
Sammelhandschrift „Meine Gedichte“ zu, in die er seit 1833 zunächst nur Gedichte
und später auch Prosaskizzen und tagebuchartige Notizen eintrug, darunter die
Gefühlswallungen während seines Aufenthalts in Hamburg anlässlich der
Konfirmation von Bertha in Hamburg, als er nicht wahrhaben wollte, dass er von
dem Mädchen nicht wiedergeliebt wurde. (Vergl. das Kapitel Das süße Lächeln
starb dir im Gesicht)
In der Novelle schildert Storm die
Begegnung eines jungen Mannes, der sich als Soldat auf dem Wege zu einer Fähre
im Wald verirrt hat, mit einem Mädchen, das dort den Namen Regine trägt. Gabriel
tritt in einen idyllischen Raum ein, lernt Gabriele und ihren gastfreundlichen
Urgroßvater kennen, lässt sich von dem Mädchen zum Fluss führen und verlässt sie
und ihre Welt im Morgengrauen.
Die erste Begegnung der beiden wird als
Märchenszene gestaltet und verweist auf Theodors Beziehung zu Bertha und seine
Auseinandersetzung mit Grimms Märchen:
Der Sommerwind kam über die Heide und
weckte eine Kreuzotter, die sich nicht weit davon im Staube sonnte. Sie löste
ihre Spirale und glitt über den harten Boden; das Kraut rauschte, als sie den
schuppigen Leib hindurchzog.
Der Schlafende wandte den Kopf, und
halb erwachend sah er in das kleine Auge der Schlange, die neben seinem Kopfe
hinkroch. Er wollte die Hand erheben, aber er vermochte es nicht; das Auge des
Gewürmes ließ nicht von ihm. So lag er zwischen Traum und Wachen. Nur wie durch
einen Schleier sah er endlich die Gestalt eines Mädchens auf sich zukommen,
kindlich fast, doch kräftigen Baues, das Haar in dicken blonden Zöpfen. Sie bog
die Ranken zur Seite und setzte sich neben ihm auf den Boden. Das Auge der
Schlange ließ ihn los und verschwand; er sah nichts mehr.
Dann kam der Traum. Da war er wieder
der Hans im Märchen, wie er es oft als Knabe gewesen war, und lag im Grase vor
der Schlangenhöhle, um die verzauberte Prinzessin zu erlösen. Die Schlange kam
heraus und rief
„Aschegraue Wängelein,
Weh dem armen Schlängelein!“
Da küßte er die Schlange, und da war's
geschehen. Die schöne Prinzessin hielt ihn in ihren Armen, und – wunderlich war
es – sie trug ihr Haar in zwei aschblonden Zöpfen und ein Mieder wie eine
Bauerndirne.
Peter Wapnewski
hat für seine Interpretation der Novelle nach möglichen Quellen für Storms
Motive geforscht, ist aber nicht fündig geworden. Es handelt sich um Elemente
eines Zaubermärchens, in dem sich Irreales und Reales miteinander verbinden.
Storm hat das Motiv erfunden und später im Fortgang der Handlung mit einem
weiteren Motiv aus seiner Schneewittchenszene verbunden.
Gabriel ging schweigend hinter ihr her; er hörte
nichts als das Rauschen ihrer Füße in dem überjährigen Laube und das Arbeiten
der Käfer in den Baumrinden; kein Luftzug; nur das feine elektrische Knistern in
den Blättern rührte sich kaum hörbar. Nach einer Weile kam aus dem Dunkel des
Waldes etwas angerannt und trabte ihnen zur Seite. Gabriel sah zwei Augen in
seiner Nähe blitzen. „Was ist das?“ fragte er. Ein Rehkalb sprang in den Weg.
„Das ist mein Kamerad!“ rief das Mädchen; dann lief sie pfeilschnell auf dem
Steige fort; das Tier hinter ihr drein.
Storms Leila/ Silvia/ Regine trägt
wiederum die Züge seines Bertha-Imago, das er sich von der 14jährigen Betha
erträumte. Malte Stein erläutert in seiner umfangreichen Analyse
diese Szene so: Träumend imaginiert Gabriel eine „Verwandlungsgeschichte“, in
der er als Märchenheld Hans die „in eine Schlange verzauberte Prinzessin durch
seinen Kuß erlöst“. So jedenfalls hat man die Szene bislang immer aufgefaßt,
nicht weiter bekümmert darum, daß ja zumindest doch eines der dargestellten
Geschehenselemente ins Schema einer „Erlösung“ nicht paßt: Just beim Erblicken
ihres angeblichen Retters verfällt die Prinzessin in „Weh“-Rufe, womit sie
unmittelbar vor ihrer Verwandlung ein deutliches Mißbehagen (wenn nicht gar
Schrecken) zum Ausdruck bringt. Den Anlaß dazu geben offenkundig die grauen „Wängelein“,
welche nicht etwa ihr selbst zuzuordnen sind – der „armen“ Schlange –, sondern
dem Hans vor der Höhle, von dessen „aschegraue[m]“ Antlitz geküßt zu werden nach
geläufiger Farbsymbolik kaum Gutes verheißen kann.
Und in der Tat, die Wirkung des Kusses
ist „wunderlich“. Denn es erschöpft sich der Zauber nicht darin schon, aus dem
Tier einen Menschen zu machen. Sobald man unterstellt, daß die geträumte
„Prinzessin“ ein Abbild der von Gabriel kurz vorher erblickten Regine ist – wozu
ihr „Mieder“ einer „Bauerndirne“ berechtigt –, läßt sich bei einem Vergleich der
beiden Mädchenerscheinungen eine zweite Verwandlung erkennen: Regine, wie
Gabriel sie vor seinem Traum auf sich zukommen sah, hatte zwei „blonde Zöpfe“
(335), die „Prinzessin“ im Traum dagegen trägt „aschblonde Zöpfe“. Im
Übergang von der Real- zur Traumgestalt ist der „dicke“ (335) Haarschopf – in
blondem Zustand ein Zeichen für Lebenskraft und sexuelle Potenz – aschfarben
geworden, wofür als Ursache nur die Berührung der ebenso „aschegrauen“ Wangen in
Frage kommt. Mit einer Art Todeskuß hat der „Hans im Märchen“ seine ihm ins
Gesicht geschriebene Antivitalität auf sein „armes“ Objekt übertragen.
Während des kurzen Zusammenseins ändert
sich Gabriels Wahrnehmung des Mädchens, das zunächst kindlich wirkt. Sie
erschien ihm auf einmal so stolz und jungfräulich; er konnte die Augen nicht von
ihr lassen, als sie in den Mondschein hinauswies und ihm die Wege zeigte, die er
gehen sollte. Als Gabriel den Wald
verlässt, sagt er: „Gute Nacht; – – – wo
find ich dich denn wieder?“
Nach Malte Steins psychoanalytischer
Analyse
hat Storm einen jungen Mann dargestellt, der zur Wahrung nicht etwa nur
seines Selbstwertgefühls, sondern zur Aufrechterhaltung überhaupt seines
Empfindens von Selbstidentität einer fortwährenden Beachtung und Spiegelung
durch andere bedarf. Und weiter heißt es: Innerhalb der Traumwelt gelangt
Gabriel an ein Objekt, welches ihm mit Umarmung und Augenkontakt wiederum Halt
bietet, im Gegensatz zu der Kreuzotter aber keine Gefahr mehr darstellt. Der
Verwandlungskuß seines geträumten Ich läßt aus der Schlange ein Mädchen werden,
das in Angleichung an des Kußgebers „aschegraue“ Wangen „zwei aschblonde Zöpfe“
trägt. Durch den gefürchteten Kuß (als ein die vorherige Bedrohungslage
umkehrendes Äquivalent zum Schlangenbiß) ist schlagartig hinweggezaubert, was
auf konnotativer Ebene erotisch-sexuelle Signifikanz besaß – sowohl die
Schlangengestalt der „verzauberten Prinzessin“ als auch die „dicke blonde“
Haarpracht der zuvor noch im Halbwachen registrierten Regine. Am Ende des
Traumgeschehens blickt Hans alias Gabriel einem ätherisch anmutenden Wesen in
die (himmel-) „blauen Augen“, dessen „junges Antlitz“ er über dem seinen
engelsgleich „schweben“ sieht (336). Die intime Nähe ist nicht länger
bedrohlich, nachdem es das Traum-Ich geschafft hat, aus der zum „Schlängelein“
verkleinerten Schlange – dem biblischen Geschöpf der Klugheit, der Versuchung
und des Todes – eine „Prinzessin“ mit „marienfrommem Nimbus“ – eine regina coeli
– zu machen.
Verstanden als Wunschphantasie, mit der
sich das träumende Subjekt eine Konfliktlösung entwirft, reflektiert dieses
Traumgeschehen den aktuellen Beziehungsbedarf des Protagonisten. Es deutet sich
an, daß der nach einem Engel benannte Gelehrte und Dichter die ihm notwendige
Beziehung dann aufrechterhalten, zulassen und nutzen kann, wenn seine
Bezugsperson weder Sexualität noch Vergänglichkeit zu kennen scheint. Keine von
Evas Erbinnen soll ihn anblicken und in den Armen halten, sondern ein Wesen, das
wie eine Himmelsgestalt von der irdischen Generativität und Sterblichkeit – von
„Hochzeit, Taufen und Todestagen“ (343) – ausgenommen bleibt.
In den die Erzählung abschließenden
Gedicht unterstreicht Gabriel seine sexuelle Interesselosigkeit an dem Mädchen.
Genau darauf hat Theodor Wagner mit seiner Bemerkung aus dem Gefühl der Liebe
das der Freundschaft zu machen hingewiesen.
Im Modus des Konjunktivs wird ein Bild
jenes Mädchens imaginiert, von dem sich Gabriel gerade verabschiedet hat. In der
Novelle heißt es dort: Sie selber standen noch im Schatten; aber bei der
Fülle des Lichtes, die draußen webte, konnte er ihre ganze Gestalt erkennen und
jedes Regen ihrer Gliedmaßen. […] Sie erschien ihm auf einmal so stolz und
jungfräulich; er konnte die Augen nicht von ihr lassen, als sie in den
Mondschein hinauswies und ihm die Wege zeigte, die er gehen sollte. […] Er
verlor sich stumm in ihren Augen; eine Nachtigall schlug plötzlich neben ihnen
aus den Büschen, die Blätter säuselten. Sie stand ihm gegenüber, ohne Regung,
kaum belebt von lindem Atmen; nur in ihren Augen, im tiefsten Grunde rührte sich
die Seele; er wußte nicht, was so ihn anschaute. […] Er küßte sie. »Gute Nacht,
Regine!« Sie löste ihre Hände von seinem Halse. Dann schritt er in die Mondnacht
hinaus; und als er nach einer Weile am Ende der Wiese zurückblickte, da war es
ihm, als stehe die schöne kindliche Gestalt noch immer an der Stelle, wo er von
ihr gegangen, unbeweglich im schwärzesten Tore des Waldes.
Die Szene wird noch einmal mit den
Attributen Mondesmärchenpracht, Waldesschatten und Sommernacht
idyllisiert. Eine mögliche Rückkehr des lyrischen Ichs aber wie im Träume
wäre sinnlos, denn Silvia würde Niemals hinunter in die Welt schreiten.
Wagner hat dies so gelesen, als ob Storm sich beim Schluss Ihrer
Liebesgeschichte ganz nach meinen Grundsätzen genügsam darüber ausgesprochen
habe. Wahrscheinlich hat Storm in seinem nicht erhaltenen Brief vom Unterschied
zwischen Liebe und Freundschaft gesprochen, was Wagner so verstanden hat, dass
sein Freund aus dem Gefühl der Liebe das der Freundschaft machen wollte.
Dass Storm bei seinen weiteren
literarischen Erzählexperimenten nicht bereit war, dem Rat des Freundes zu
folgen, zeigt eine Novelle, die er ein paar Jahre später mit dem Titel Im
Saal im „Volksbuch auf das Jahr 1849“ veröffentlicht. In ihr hat Storm seine
Erlebnisse mit Bertha literarisch verarbeitet, wie folgende Auszüge
dokumentieren:
Am Nachmittag war Kindtaufe gewesen;
nun war es gegen Abend. Die Eltern des Täuflings saßen mit den Gästen im
geräumigen Saal, unter ihnen die Großmutter des Mannes; die andern waren
ebenfalls nahe Verwandte, junge und alte, die Großmutter aber war ein ganzes
Geschlecht älter, als die ältesten von diesen. Das Kind war nach ihr »Barbara«
getauft worden; doch hatte es auch noch einen schöneren Namen erhalten, denn
Barbara allein klang doch gar zu altfränkisch für das hübsche kleine Kind.
Dennoch sollte es mit diesem Namen gerufen werden; so wollten es beide Eltern,
wieviel auch die Freunde dagegen einzuwenden hatten. Die alte Großmutter aber
erfuhr nichts davon, dass die Brauchbarkeit ihres langbewährten Namens in
Zweifel gezogen war. […] Der Prediger hatte nicht lange nach Verrichtung seines
Amtes den Familienkreis sich selbst überlassen; nun wurden alte, liebe, oft
erzählte Geschichten hervorgeholt und nicht zum letzten Male wiedererzählt. […]
„So war es einmal an einem
Augustnachmittage, als dein Großvater die kleine Gartentreppe herabkam; aber
dazumalen war er noch weit vom Großvater entfernt. – […] In der Schaukel vor der
Laube saß ein achtjähriges Mädchen; sie hatte ein Bilderbuch auf dem Schoß,
worin sie eifrig las; die klaren goldnen Locken hingen ihr über das heiße
Gesichtchen herab, der Sonnenschein lag brennend darauf. ‚Wie heißt du?ʼ fragte
der junge Mann. Sie schüttelte das Haar zurück und sagte: ‚Barbara.ʼ ‚nimm dich
in acht, Barbara; deine Locken schmelzen ja in der Sonne.ʼ Die Kleine fuhr mit
der Hand über das heiße Haar, der junge Mann lächelte – und es war ein sehr
sanftes Lächeln. – – ‚Es hat nicht Notʼ, sagte er; ‚komm, wir wollen schaukeln.ʼ
Sie sprang heraus: ‚Wart, ich muss erst mein Buch verwahren.ʼ Dann brachte sie
es in die Laube. Als sie wiederkam, wollte er sie hineinheben. ‚Neinʼ, sagte
sie, ‚ich kann ganz allein.ʼ Dann stellte sie sich auf das Schaukelbrett und
rief: ‚Nur zu!ʼ – Und nun zog dein Großvater, dass ihm der Haarbeutel bald
rechts, bald links um die Schultern tanzte; die Schaukel mit dem kleinen Mädchen
ging im Sonnenschein auf und nieder, die klaren Locken wehten ihr frei von den
Schläfen. Und immer ging es ihr nicht hoch genug. Als aber die Schaukel
rauschend in die Lindenzweige flog, fuhren die Vögel zu beiden Seiten aus den
Spalieren, dass die überreifen Aprikosen auf die Erde herabrollten. ‚Was war
das?ʼ sagte er und hielt die Schaukel an. Sie lachte, wie er so fragen könne.
‚Das war der Iritsch [Hänfling]ʼ, sagte sie, ‚er ist sonst gar nicht so bange.ʼ
Er hob sie aus der Schaukel, und sie gingen zu den Spalieren; da lagen die
dunkelgelben Früchte zwischen dem Gesträuch. ‚Dein Iritsch hat dich traktiert!ʼ
sagte er. Sie schüttelte mit dem Kopf und legte eine schöne Aprikose in seine
Hand. ‚Dich!ʼ sagte sie leise. Nun kam dein Urgroßvater wieder in den Garten
zurück. ‚Nehm Er sich in achtʼ, sagte er lächelnd. ‚Er wird sie sonst nicht
wieder los.ʼ Dann sprach er von Geschäftssachen, und beide gingen ins Haus. Am
Abend durfte die kleine Barbara mit zu Tisch sitzen; der junge freundliche Mann
hatte für sie gebeten. – So ganz, wie sie es gewünscht hatte, kam es freilich
nicht; denn der Gast saß oben an ihres Vaters Seite; sie aber war nur noch ein
kleines Mädchen, und musste ganz unten bei dem allerjüngsten Schreiber sitzen.
Darum war sie auch so bald mit dem Essen fertig; dann stand sie auf und schlich
sich an den Stuhl ihres Vaters. Der aber sprach mit dem jungen Mann so eifrig
über Konto und Diskonto, dass dieser für die kleine Barbara gar keine Augen
hatte. – Ja, ja, es ist achtzig Jahre her; aber die alte Großmutter denkt es
noch wohl, wie die kleine Barbara damals recht sehr ungeduldig wurde und auf
ihren guten Vater gar nicht zum besten zu sprechen war. Die Uhr schlug zehn, und
nun musste sie gute Nacht sagen. Als sie zu deinem Großvater kam, fragte er sie:
‚Schaukeln wir morgen?ʼ, und die kleine Barbara wurde wieder ganz vergnügt. –
‚Er ist ja ein alter Kindernarr, Er!ʼ sagte der Urgroßvater; aber eigentlich war
er selbst recht unvernünftig in sein kleines Mädchen verliebt. Am andern Tage
gegen Abend reiste dein Großvater fort. Dann gingen acht Jahre hin. Die kleine
Barbara stand oft zur Winterzeit an der Glastür und hauchte die gefrornen
Scheiben an; dann sah sie durch das Guckloch in den beschneiten Garten hinab und
dachte an den schönen Sommer, an die glänzenden Blätter und an den warmen
Sonnenschein, an den Iritsch, der immer in den Spalieren nistete, und wie einmal
die reifen Aprikosen zur Erde gerollt waren, und dann dachte sie an einen
Sommertag und zuletzt immer nur an diesen einen Sommertag, wenn sie an den
Sommer dachte. – So gingen die Jahre hin; die kleine Barbara war nun doppelt so
alt und eigentlich gar nicht mehr die kleine Barbara; aber der eine Sommertag
stand noch immer als ein heller Punkt in ihrer Erinnerung. – Dann war er endlich
eines Tages wirklich wieder da.“
„Wer?“ fragte lächelnd der Enkel, „der
Sommertag?“ „Ja“, sagte die Großmutter, „ja, dein Großvater. Es war ein rechter
Sommertag.“ „Und dann?“ fragte er wieder. „Dann“, sagte die Großmutter, „gab es
ein Brautpaar, und die kleine Barbara wurde deine Großmutter, wie sie hier unter
euch sitzt und die alten Geschichten erzählt.“
So also stellte sich Theodor in den Jahren
um 1840 seine Zukunft
mit Bertha vor, als er wieder in Kiel den zweiten Teil seines Jura-Studiums
absolvierte. Es ist dieser Kontrast zwischen zwei entgegengesetzten Bildern von
Bertha, die der junge Poet imaginierte, das des unschuldigen Kindes und das der
reifen Jungfrau, die er begehren kann.
In zeitlicher Nähe zu dieser Novelle
findet sich im Kalendarium zum Monat Mai noch ein Gedicht, das ebenfalls einen
Bezug zu dem Motiv des Erwachsenwerdens und der Wiederholung der Kindheit in den
nächsten Generationen wie in der Novelle „Im Saal“ aufweist.
|
Die Kränze, die du dir als Kind gebunden,
Sie sind verwelkt und längst zu Staub verschwunden;
Doch blühn wie damals noch Jasmin und Flieder
Und Kinder binden deine Kränze wieder.
|
 Gedicht Storms im Volksbuchs 1849
Gedicht Storms im Volksbuchs 1849 |
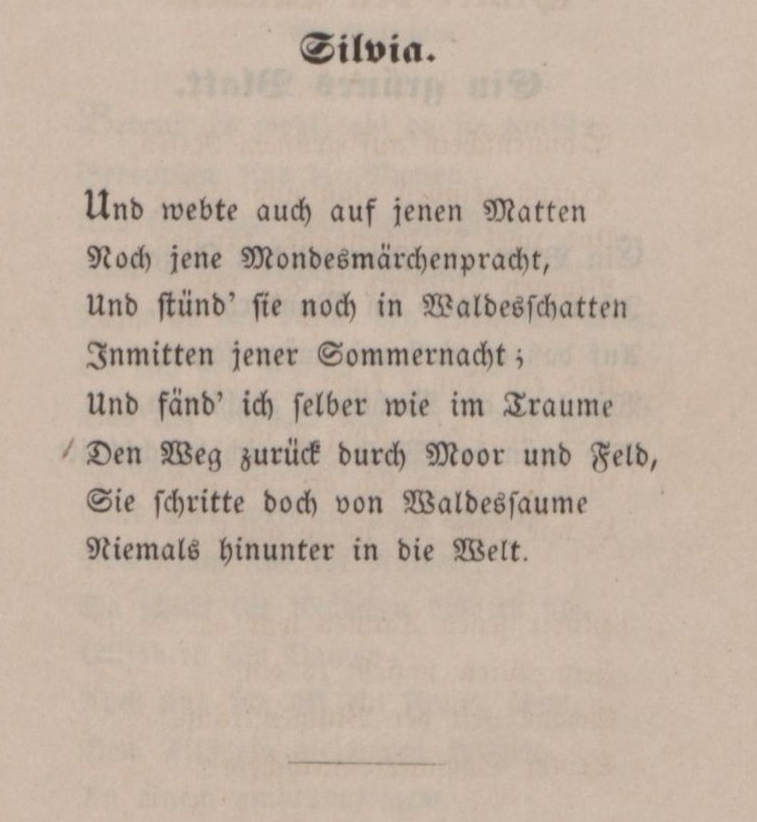 Erstdruck in Storms Gedicht-Ausgabe
1852
Erstdruck in Storms Gedicht-Ausgabe
1852 Gedicht Storms im Volksbuchs 1849
Gedicht Storms im Volksbuchs 1849