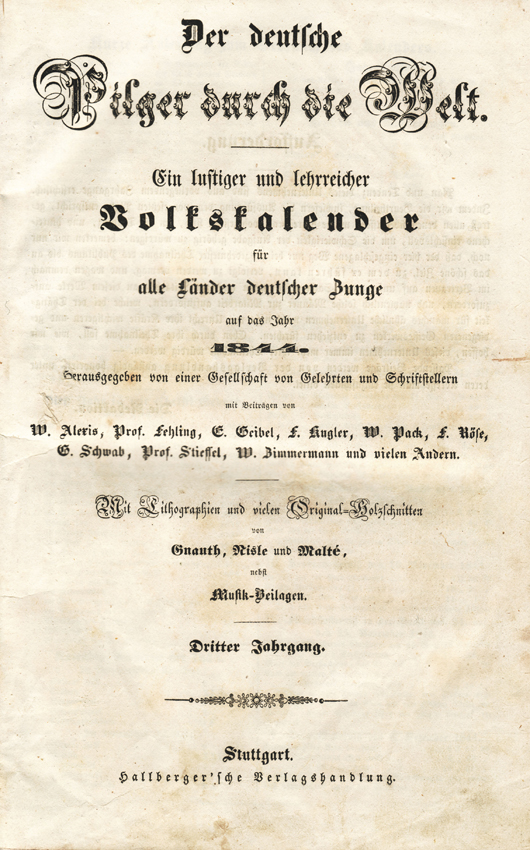
„War ein Gesell zu Riekestadt“ ‒ Ein Gedicht von Theodor Storm?
In Theodor Storms autobiographischer Erzählung „Beroliniana“ wandert ein „Doktor Wanst“[1], mit seinen drei Kommilitonen durch den Grunewald. Der Studiosus „Nordheim“[2] wundert sich, dass man sich in der „Nähe dieser alten Stadt so gut amüsieren kann.“ Da widerspricht ihm der Doktor:
[…] die alte staubige Stadt bietet dir mehr als irgend eine, wo du bis jetzt gewesen, wenn du eben nur unbefangen das genießt, was da ist, und dich nicht gerade nur um das bekümmerst, was nicht da ist. ‒ Wartet“, fuhr er fort, „ich will euch ein Lied singen, paßt mir gut auf“ <. . .> und fistulierte, wie folgt:
War ein Gesell zu Riekestadt,
Der fuhr zum Tor hinaus,
Und als er in der Fremde war,
Da war er nicht zu Haus.
Da schien ihm alles schief und schlecht
Und nichts nicht schien ihm recht.
Der Gesell trank gern ein gut Glas Wein,
Er trank es alle Tag
Und wie er in die Fremde kam,
Da fragt er gleich danach.
Da schmeckt der Wein ihm sauer sehr
Und macht ihm groß Beschwer.
Doch konnt er nicht vom Weine lân,
Das war halt gewaltig dumm,
Viel Bessers gab's noch in der Fremd,
Tat sich danach nicht um.
Die Mädels all so blank und schön
Hat er nit angesehn.
Da sprach der Meister, lieber Sohn,
Du drehst das Spiel nit recht;
Denn wo du umschaust, ist doch halt
Das gut und jenes schlecht.
Drum laß Gesell das Picheln sein
Und leg dich auf die Mägdelein!
Nach diesem Vortrag heißt es weiter:
„Merkst du was“, rief Ezzel; „das geht auf dich Nordheim, bedank dich!“ „Ja“, pflichtete dieser bei, „der Doktor hat ein moralisch Lied gemacht, und will damit meine Grundsätze verbessern. Schade nur um seinen letzten guten Rat! Mein Autor hat leider schon das Kapitel von der Liebe ausgelassen ‒ ‒ Ha, ha, ha, Schade, lieber Doktor, Schade! Aber was fangen wir an, wenn wir zu Hause kommen? Wenn des Doktors Wirtin nur nicht wieder vor Gericht ist, damit sie nicht in Contumaz verurteilt wird [d.h. wegen Nichterscheinen vor Gericht, G.E.], so möchte ich vorschlagen, heute Abend bei ihm den Tee einzunehmen!“
Theodor Storm hatte nach dem Wintersemester 1837/38 sein Jura-Studium in Kiel unterbrochen, war im April 1838 nach Altona gefahren, von wo aus er mehrmals Bertha von Buchan in Hamburg besuchte, in die er sich verliebt hatte. In Altona wohnte er bei Jonas Heinrich Scherff (1798-1882), einem Kaufmann, der mit Friederike Henriette, geb. Alsen (1802-1876) verheiratet war, einer Cousine von Storms Mutter. Dort war der Primaner Weihnachten 1836 einem zehnjährigen Mädchen begegnet, die mit ihrer Pflegemutter Therese Rowohl in Hamburg wohnte und ebenfalls bei den Scherffs eingeladen war.
Gut vier Jahre später, am 11. März 1841 ‒ Bertha war nun 15 Jahre alt ‒, vertraute Storm Friederike Scherff Folgendes an[3]: „Seitdem ich sie an dem Weihnachtsabend gesehen hatte, den ich noch bei Lebzeiten Deiner vortrefflichen Mutter mit Euch verlebte, bildete sich ein Gedanke bei mir aus, dies Mädchen geistig an mich zu fesseln. Und jetzt muß ich Dir das Manchen vielleicht Unbegreifliche sagen, ich habe schon damals das Kind geliebt.“
Zunächst aber schrieb der verliebte Theodor Gedichte und das Märchen „Hans Bär“ für Bertha und kultivierte eine platonische Kinderliebe, indem er sich ein „Lockenköpfchen“ ausmalte, auf das er seine erotischen Wunschvorstellungen in einer Reihe von Liebesgedichten projizieren konnte.
Ferdinand Röse[4], den Storm während seines Schulbesuchs von Herbst 1835 bis Ostern 1837 im Lübecker Katharineum kennengelernt hatte, studierte bereits seit dem Herbst 1836 an der Berliner Universität. In seinem Röse-Essay[5] berichtete Storm darüber: „Ein halb Jahr später ging ich nach Kiel, und ein Jahr danach mit Röse, und Mantels, von Hamburg aus nach Berlin. Ich entsinne mich aus diesem Zusammenleben nur einer Tour nach dem Grunewald, die auch der nachherige Shakespeare-Gelehrte Delius mitmachte, und einiger Theaterabende, die uns durch Seidelmann bedeutsam wurden; nach einer Faust-Aufführung kauften wir uns ein Fläschchen herben Ungar, und plauderten dabei noch ein paar Stunden auf meiner Stube. Nach einem halben Jahr verließ Röse Berlin.“
Noch im Sommer 1838 hat Storm einen Text mit dem Titel „Beroliniana“[6] geschrieben, in dem er in satirischer Weise von Fahrt nach Berlin und von seinen dortigen Erlebnisse als Student erzählt: „Erlebnisse des Studiosen Nordheim, nacherzählt und seinen Freunden Krebs und Klander gewidmet von HTW Storm“.
Auch in diesem Text spielt die Erinnerung an Bertha von Buchan eine wichtige Rolle; bereits im ersten Kapitel „Wie der Studiosus Nordheim in Berlin einfuhr und es doch nicht zu sehen bekam“ träumt der Protagonist von dem Mädchen, das er gerade verlassen hat: „Das war schon der zweite Morgen nach der zweiten Nacht, den der Studiosus Nordheim auf der Preußischen Postkutsche erwachte; müde und matt von dem ewigen Fahren hatte er sich in die eine Ecke gedrückt, die Augen fest zu gemacht, und während der Wagen die Chaussee daherrasselte, träumte ihn so allerlei von seinem Vaterstädtchen an der grauen Nordsee, von seinen lieben Eltern daheim, von den letzten acht Tagen, die er auf seiner Reise bei guten, von ihm geliebten Menschen zugebracht hatte, von Scheiden und Meiden, von blauen Augen und – – –“
Die sich anschließende Erzählung berichtet in launiger Weise von einigen Erlebnissen und Aktivitäten der Studenten in Berlin; Storm schließt sich der heiteren Darstellungsweise von Autoren wie ETA Hoffmann an erzählt von eigentlich belanglosen Studentenscherzen. Über den Storm nachempfundenen Protagonisten schreibt der Verfasser: „obgleich der Studiosus Nordheim in der Heimat ein großer und feuriger Verehrer des schönen Geschlechts war, hat der Verf. unter den Berliner Erlebnissen seines Helden doch nichts in Erfahrung bringen können, womit er diese Lücke ausfüllen möchte, und da er fest entschlossen ist, seinen geneigten Lesern von A bis Z nur wahrhaftige faits (Tatsachen) zu erzählen, so hat er seine Phantasie an die Kette gelegt und das Kapitel ausgelassen.“
Über die Berliner Mädchen ‒ in der Studentensprache „Besen“ genannt, heißt es:
„Donnerwetter“, setzte stud. Fite kräftig begeistert ein, „was gibt es in Berlin übrigens doch auch famose Dirnen. Was für’n Teint haben die Besen! Das ist ja wirklich was ganz ausgezeichnetes.“ Dabei betonte er seine Worte, als enthielte jedes eine mathematische Wahrheit.
„Freilich“, meinte Nordheim, „hier in Berlin muß es wohl geraten, wenn die Mägdelein mit 6 Jahren schon mit Sonnenschirmen und die kleinen Buben, wie ich neulich gesehn habe, in Schlafrock und Pantoffeln herumspazieren.“
„Wie sind sie alle gewachsen“, fuhr ersterer fort, ohne sich von seinem Gegenstande ableiten zu lassen, „und wie wissen die Personen sich zu kleiden! – Da müssen unsre Landsmänninnen doch weit hinter ihnen zurückstehen!“
„Laß unsre Landsmänninnen aus dem Spiel“, drohte Nordheim, „da drüben im Vaterlande gibt’s Gott verd – m mich, auch Mädchen, und ich denke, bei ihnen ist der Kern gesünder, als bei diesen hier. Berlinsch Kind, Spandauer Maid und Charlottenburger Pferd sind alle drei nichts wert! Übrigens will ich dir alles mögliche zugestehn, ihre Toilette wissen sie zu machen, und eine gewisse tournure (Schlagfertigekit) gibt ihnen die Hauptstadt auch samt und sonders von der Gräfin bis zur Handwerkstochter hinab. Das ist aber alles nur äußerlich und eine große Menge unsrer Mädchen stehn ihnen darin nicht nach.“
Als dem Studiosus von seinem Freund, der nach Ferdinand Röse gestaltet ist, zu einem deftigen Liebesabenteuer geraten wird, weist dieser die Anspielung auf die entfernte Bertha mit dem Hinweis darauf zurück, dass der Autor dieses Textes absichtlich das Kapitel von der Liebe ausgelassen habe.
In Berlin ‒ so lesen wir in den letzten Versen des auf Theodor Storm gemünzten Gedichts ‒ habe sich Nordheim (in der anzüglichen Doppeldeutigkeit des Verses) nicht auf die Mägdlein gelegt und scheint also seiner angebeteten Bertha treu geblieben zu sein, allerdings hat er den Freunden von ihr vorgeschwärmt. Das belegen eine Reihe von Gedichten, darunter sechs, die er in das Stammbuch seines Berliner Studienfreunde Theodor Wagner eingetragen hat[7], in dem er auch von einer Theateraufführung der Liebhabertruppe „Theatro alla Scala“ vom Februar 1839 berichtet, bei der als Mitwirkender aufgeführt wird „Herr Storm, ein unverbesserlicher Liebhaber“.
Der erste Vers des Gedichts spielt mit dem Hinweis „ein Gesell zu Riekestadt“ auf Storms häufige Besuche bei den Scherfs in Altona an und auf die Vertrautheit mit Friederike Scherf, die „Rieke“ genannt wurde.
Folgt man der literarische Fiktion, so stammt das Gedicht aus der Feder des Doktor Wanst, der es mit hoher Fistelstimme in parodistischer Weise vorträgt. Das deutet darauf hin, dass es sich um einen Text von Ferdinand Röse handeln könnte, den Storm in seine Erzählung aufgegriffen hat.
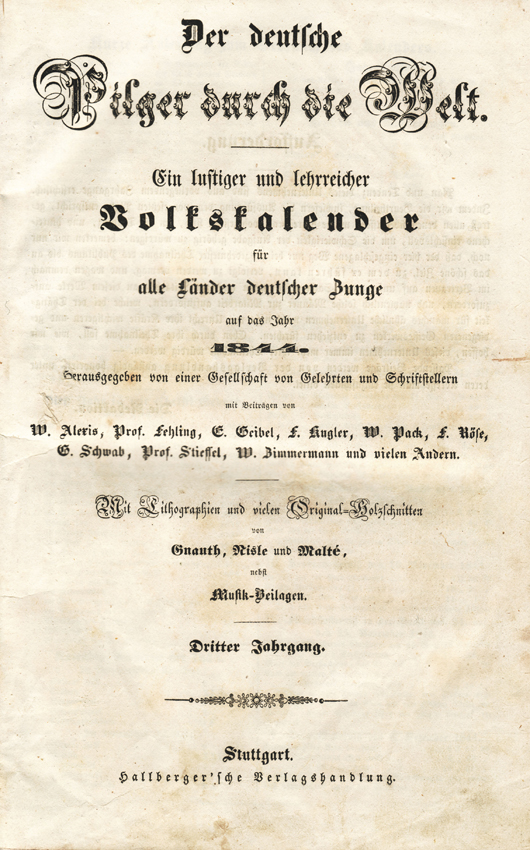
Sechs Jahre später veröffentlichte Röse in dem Volkskalender „Der deutsche Pilger durch die Welt“ unter dem Titel „Vetter Michels Eisenbahn. Eine unglaublich wahre Geschichte des Herrn Magister Antonius Wanst“ eine Erzählung in Briefform, in der er die Reiselust einen Spießers aus Norddeutschland verspottet.[8] An den Schluss setzte er „Ein Lied, welches der Herr Magister Antonius Wanst sang, als er den letzten Brief Vetter Michels gelesen hatte“. Das zweistrophige Gedicht gibt die ersten sechs Zeilen des Gedichts aus Storms „Beroliniana“ wieder, die durch eine zweite ergänzt, in der er versucht, „das ursprünglich wohl tatsächlich auf Storm gemünzte Lied dem neuen Zusammenhang anzupassen“.[9] Statt „Riekestadt“ steht für den Herkunftsort des „Gesellen“ nun „Kiekestadt“.


Rechts über den Noten steht „Th. Storm.“ und im Inhaltsverzeichnis (S. 203) heißt es „componirt von Th. Storm“.
Leopold Hirschberger, der das Lied 1916 im Gedenkbuch anlässlich des 100. Geburtstags von Theodor Storm unter dem Titel „Theodor Storm als Komponist“ veröffentlichte[10], schreibt: „Ich denke mir die Sache so, daß Röse dem begabteren Freunde sein Werkchen, bevor er es der Redaktion des Kalenders zusandte, zur Durchsicht gab und von ihm als zustimmende Antwort das kleine Scherzgedicht mit hinzugefügter Melodie erhielt.“
Ob sämtliche Strophen des Gedichts von Theodor Storm stammen oder zumindest in enger Zusammenarbeit mit Ferdinand Röse verfasst wurden, lässt sich aus den überlieferten Dokumenten nicht beantworten. Allerdings hat Röse nicht über eine poetische Begabung verfügt wie seine Freunde Immanuel Geibel und Theodor Storm und war auf deren Mithilfe angewiesen, wie Storm in seiner Handschrift seines Röse-Essays anmerkte: „Röse klagte mehrfach daß ihm das Talent der schönen Formgebung fehlte, was nach siner Meinung Geibel in vollem Maße besaß“. Und über Röse Märchen „Das Sonnenkind“[11] schrieb Storm: „Nur für den Liederbedarf des Hans Fiedeldum, den Du allein nicht zu decken wußtest, wurde die Beisteuer der Freunde in Anspruch genommen. Geibel hatte aus seinem Reichthum schon gegeben; dann schrieb auch ich die kleinen „Fiedellieder“, wie sie noch jetzt in der Sammlung meiner Gedichte stehen.“[12]
Nun geht der Mond durch Wolkennacht.
Nun ist der Tag herum,
da schweigen alle Vögel bald
Im Walde um und um.
Die Amsel pfeift ihr letztes Lied,
Ein Lied zu allerbest;
Die Drossel schlägt den letzten Ton
Und fliegt in’s warme Nest.
Da nehm' auch ich zu guter Nacht
Zur Hand die Fiedel mein,
Das ist ein fröhlich Nachtgebet
Und klingt zum Himmel ein.[13]

Anmerkungen
[1] Ferdinand Röse (1815-1859) wurde von seinen Freunden Magister oder Doktor Antonius Wanst genannt. Theodor Storm: Ferdinand Röse. In: Theodor Storm, Sämtliche Werke in 4 Bänden, hrsg. von Karl Ernst Laage und Dieter Lohmeier. Frankfurt a.M. 1987f. LL 4, S, 441-467; Anm. S. 940-948.
[2] Als „Norheim“ lässt Storm sich selbst in seiner Erzählung auftreten. Theodor Storm: Beroliniana. In: LL 4, S, 448-466; Anm. S. 948-954.
[3] Theodor Storm an Friederike Scherff; eigenhändiges Brieffragment (Entwurf?), 1 S., StA, Husum. Hier nach der Handschrift. Vergl.: Storms erste große Liebe. Theodor Storm und Bertha von Buchan in Gedichten und Gedanken. Hrsg. und kommentiert von Gerd Eversberg. Heide 1995. (Editionen aus dem Storm-Haus 8.)
[4] Johann Anton Ferdinand Röse, geboren zu Lübeck am 27. September 1815 als Sohn eines Kornmaklers, sollte anfänglich Buchhändler werden, entschied sich aber dann, einem inneren Drange folgend, für den Gelehrtenstand, empfing seine Vorbildung auf dem Gymnasium seiner Vaterstadt, studirte 1836-40 in Berlin, Basel und München Philosophie und Kunstgeschichte, versuchte sich hierauf als Docent zu Basel und (1847-49) Tübingen, lebte dann als Privatgelehrter und Volksschriftsteller in Stuttgart, Augsburg und Berlin und zuletzt in trauriger Abgeschlossenheit am Rheine, wo er am 27. November 1859 zu Krufft bei Andernach an den Folgen eines Blutsturzes starb. Bei glänzenden Geistesgaben, ernstem und energischem Streben und hoher persönlicher Liebenswürdigkeit hat es diesem ältesten und nächsten Freunde Emanuel Geibel's auf seinem reich und abenteuerlich bewegten Lebensgange gleichwohl niemals glücken wollen, das Ziel seiner Wünsche, ein öffentliches philosophisches Lehramt, das ihm eine unabhängige Stellung gesichert Hütte, zu erringen, ein Mißgeschick, dessen Ursachen wohl zunächst in der Ungunst äußerer Umstände, zum Theil aber auch in Röse's ökonomischer Sorglosigkeit und in seinem starken Selbstgefühl zu suchen sind, das ihn verhinderte, sich auch nur zeitweilig unterzuordnen. Seine bedeutendsten Leistungen liegen auf dem Gebiete der Philosophie. […]
Karl Hugo Schramm-Macdonald in: Allgemeine Deutsche Biographie 29 (1889), S. 186-187.
[5] Theodor Storm: Ferdinand Röse. In: LL 4, S. 445.
[6] LL 4, S. 448-466.
[7] Ein Stammbuchblatt und acht Jugendgedichte Theodor Storms. In: Friedrich Düsel (Hrsg.): Theodor Storm. Gedenkbuch zu des Dichters 100. Geburtstage. Braunschweig 1916, S. 35-44.
[8] Ein Lied, welches der Herr Magister Antonius Wanst sang, als er den letzten Brief Vetter Michels gelesen hatte. In: Ferdinand Röse: Vetter Michels Eisenbahn. Eine unglaublich wahre Geschichte des Herrn Magister Antonius Wanst. In: Der deutsche Pilger durch die Welt. Ein lustiger und lehrreicher Volkskalender für alle Länder deutscher Zunge auf das Jahr 1844. Stuttgart 1843, S. 3-14.
[9] Dieter Lohmeier im Kommentar, LL 4, S. 953.
[10] Theodor Storm als Komponist. Ein Fund von Dr. Leopold Hirschberg. In: Friedrich Düsel, S. 148-151.
[11] Ferdinand Röse: Das Sonnenkind. In: Der deutsche Pilger durch die Welt. Ein lustiger und lehrreicher Volkskalender für alle Länder deutscher Zunge auf das Jahr 1845. Stuttgart 1844, S. 57-89.
[12] Theodor Storm: Vorwort zu „Die neuen Fiedellieder“. In: Theodor Storm: Zerstreute Kapitel. Berlin 1873, S. 95-98.
[13] Der deutsche Pilger durch die Welt, S. 83.