Caroline von Plechow oder Die Verfolgung von Wilhelmshaven nach Kopenhagen
2 Eine Entführung
Am nächsten Morgen saßen die Brüder gerade über ihrem Frühstück und besprachen Einzelheiten der weiteren Fahrt, als plötzlich Lärm vom Kai in ihre Kajüte drang. Sie hörten laute Stimmen, die Schiffswache sprach mit einem Fremden, Schritte polterten über Deck, dann klopfte es an der Tür. Paul öffnete und sah sich Kapitän Ollive gegenüber, der sichtlich irritiert einen jungen Mann daran hinderte, direkt in die Kajüte zu stürzen. Paul erkannte in ihm einen der Offiziere, die bei der gestrigen Abendgesellschaft zugegen waren und frage:
„Mein Herr, was gibt es zu dieser frühen Stunde?“
Der Offizier nahm Haltung an und stieß aufgeregt hervor:
„Sie entschuldigen die Störung, meine Herren, aber es hat eine Entführung gegeben!“
„Eine Entführung?“ Jules war hinzugetreten. „Wo?“
„Im Hause des Admirals. Caroline, ich meine seine Tochter, ist spurlos verschwunden.“
Die Brüder waren bestürzt.
„Und Sie sind sicher, dass es sich um eine Entführung handelt?“ fragte Jules.
„Ganz sicher!“ erwiderte der junge Mann.
„Nun kommen Sie erst einmal herein“, forderte Paul den Offizier auf.
Dieser trat ein, und nun erst sahen die Brüder das bleiche Gesicht des jungen Mannes, der sich als Leutnant von Rochow vorstellte. Er setzte sich erst nach mehrfacher Aufforderung und begann noch immer aufgeregt zu erzählen.
Bald wurde unseren Brüder klar, was geschehen war. Der Leutnant, offenbar ein Verehrer der Admiralstochter, hatte sich während der Abendgesellschaft mit dem Mädchen für den nächsten Morgen in aller Frühe zu einem Ausritt verabredet, wie schon mehrmals in den letzten Wochen. Als das Mädchen aber nicht erschien, und als er nach längerem Warten im Hause nachfragte, konnte man dort Caroline nirgends finden. Ja, die Mutter entdeckte zu ihrem Schrecken, dass das Bett der Tochter unbenutzt war. Da keinerlei Kleidungsstücke fehlten, ließ sich nur an ein Verbrechen denken, ein Verdacht, der sogleich genährt wurde, da auch der spanische Gast, dem man den unangenehmen Abschluss des Abends verdankte, ebenso spurlos verschwunden war.
Der Vater hatte sofort Boten ausgeschickt, um bei allen Gästen des gestrigen Tages Erkundigungen einzuholen, und so wurden auch die Brüder Verne gebeten, zum Hause des Admirals zu kommen, denn dieser wollte keine Möglichkeit versäumen, um dieses seltsame und unerklärliche Verschwinden seiner Tochter aufzuklären.
Die Brüder brachen sogleich auf und folgten dem Leutnant zur Kommandantur. Sie fanden das Haus in voller Aufregung. Der Admiral bewahrte eine erstaunliche Ruhe, seine Frau aber hatte jede Fassung verloren und ließ sich nicht davon abbringen, die schlimmsten Dinge auszumalen, die ihrer Tochter zugestoßen sein mochten.
Die systematische Befragung der Gäste hatte indessen keinerlei Ergebnis gebracht, und es begann sich eine gewisse Ratlosigkeit auszubreiten, als Paul vorschlug, das Zimmer des Spaniers zu durchsuchen. Man folgte seinem Rat, fand aber nichts. Dann meinte Paul, man könne auf der Bahnstation Auskunft einholen. Der Bahnhofsvorsteher wurde einbestellt und berichtete auf Befragen, dass mit dem Frühzug acht Minuten nach sechs Uhr neben einigen Soldaten auch ein großer Mann mit einer verschleierten Dame abgereist sei, der ihm wegen des fremdländischen Akzents aufgefallen war.
Nun war man sicher, dass es sich bei seiner Begleiterin um Caroline handeln musste, doch blieb allen rätselhaft, weshalb das Mädchen mit dem fremden Grafen fort gegangen war, den sie doch – wie ein jeder ohne Mühe hatte erkennen können – verabscheute.
Man fragte den Bahnhofsvorsteher, ob ihm am Verhalten jener Frau etwas aufgefallen sei, was dieser jedoch verneinte, weil ihn andere Dienstgeschäfte an einer genaueren Beobachtung verhindert hätten.
So war man nicht viel klüger geworden, als die Versammlung wieder auseinander ging.
Die Brüder wollten sich eben zu ihrem Schiff zurückbegeben und waren vom Admiral zur Tür begleitet worden, als eine Kutsche vorfuhr, der ein hoch gewachsener, elegant gekleideter Mann entstieg. Dieser ging zielstrebig auf den Admiral zu und verbeugte sich knapp. Seine Gestalt war schlank; die kurzen blonden Haare gaben ihm ein jugendliches Aussehen, er mochte Mitte dreißig sein. Die großen blauen Augen blickten offen und interessiert; man sah sofort, dass nichts dem klaren Blick dieses Mannes verborgen bleiben konnte.
„Von Schwedenow.“ sagte er kurz, „ich fürchte, ich komme zu spät!“
„Mein Herr!“ sagte der Admiral, der nichts verstand.
„Seit einer Woche jage ich hinter dem schamlosen Verbrecher her“, erklärte der Ankömmling, „wusste aber bis gestern Abend nichts von seinem Aufenthaltsort. Nun, da ich endlich herausgefunden habe, hinter welcher Maske der Gauner sich diesmal verborgen hat, komme ich zu spät, hat er seine Tat bereits ausgeführt und ist mit großem Vorsprung entkommen. Aber“, setzte er mit einer energischen Bewegung hinzu, „vielleicht gelingt es uns, sein jüngstes Opfer noch zu retten!“
„Woher wissen Sie ...“ wollte der Admiral fragen, doch der Fremde stellte seinerseits die Frage: „Hier hat heute Nacht eine Entführung stattgefunden?“
Man bejahte, da erstarrten die Bewegungen des Mannes, er ballte die Fäuste und knirschte mit den Zähnen.
Als die Überraschung gewichen war, man sich gegenseitig vorgestellt hatte und den Herren, der sich als Graf Schwedenow zu erkennen gab, ins Haus bat – die Brüder Verne blieben selbstverständlich ebenfalls, um diese neueste der Verwirrungen aufklären zu helfen –, konnte man ihm zunächst Rechenschaft über die Ereignisse der letzten Stunden ablegen. Schwedenow hörte mit gespannter Aufmerksamkeit zu, fragte hier und da nach und erklärte schließlich kategorisch:
„Meine Herren, ich glaube, wir haben noch eine Chance, die Tochter des Hauses vor dem Schlimmsten zu retten.“
„Wieso vor dem Schlimmsten?“ rief die entsetze Mutter.
„Reden sie!“ befahl der besorgte Vater, und die beiden Franzosen blickten einander ratlos an.
Wir überlassen die Versammlung ihrer momentanen Ratlosigkeit, die sogleich durch eine detaillierte Erklärung Schwedenows beseitigt werden soll, um dem Leser die neu aufgetretene Gestalt genauer vorzustellen.
Max Graf Schwedenow, denn um diesen weit über seine Heimat hinaus bekannten und berühmten Mann handelt es sich bei dem Neuankömmling, war zum Zeitpunkt der hier erzählten Ereignisse gerade 34 Jahre alt. Der junge Adlige stammte aus altem preußischem Geschlecht, das seit vielen Generationen in der Mark Brandenburg ansässig war. Dort, vom Lieproser Herrenhaus aus, hatten die Schwedenows ihrem König treu gedient, und man kann ohne Übertreibung sagen, das Geschlecht zählte zu den ergebenen Stützen der Preußischen Monarchie.
Der junge Graf wuchs inmitten der milden märkischen Landschaft auf; sein Vater, der das Lieproser Herrenhaus und die damit verbundene Landwirtschaft mit strenger, aber weiser Hand zu lenken verstand, ließ ihn eine sehr solide Bildung durch Privatlehrer zukommen, ansonsten aber konnte der Knabe frei mit seiner Zeit schalten und walten. Denn Beschränkungen und Begrenzungen, wie sie von vielen anderen Männern von Stand als unabdingbare Erziehungsprinzipien für ihre Söhne vertreten wurden, galten dem alten Schwedenow wenig. Er sprach viel von der Achtung vor der Person, denn das hatte er als Lehre von seinem Aufenthalt an den Universitäten zu Erfurt, Weimar und Berlin mit in seine ländliche Heimat genommen. So unterschied er sich durch seine Bildung und die damit verbundene Aufgeschlossenheit für Neues von manchem seiner Standesgenossen. Dem Leben in der Residenzstadt hatte er entsagt, erst im reiferen Alter geheiratet und sich – abgesehen von gelegentlichen gegenseitigen Besuchen mit den benachbarten adeligen Familien – ganz von der Welt zurückgezogen und widmete sich nur noch seinen Büchern und Schriften.
Max nutzte diese Freiheit sehr, umso mehr als ihm das Lernen, das ihm von seinen Lehrern abverlangt wurde, leicht fiel, denn er fand genügend Zeit, durch Wald und Flur zu streifen, spielte mit den Dorfjungen, trollte zwischen den Wagen und Scheunen der Gutshöfe umher und lernte früh reiten.
Aber seine Mutter, eine zarte Frau voller musischer Talente, fürchtete um die Bildung des jungen Springinsfeld und sorgte dafür, dass Max nach Vollendung seines 12. Lebensjahres nach strengen Konventionen erzogen und auf seine herausragende gesellschaftliche Rolle vorbereitet wurde. Dabei dachte sie an eine glänzende militärische Laufbahn am preußischen Königshof zu Berlin oder an eine Karriere im diplomatischen Dienst.
Max war den Vorstellungen seiner Mutter auch gefolgt, ohne allerdings einen besonderen Ehrgeiz zu entwickeln; ganz selbstverständlich trat er als Offiziersanwärter in das Regiment der Gardes du Corps zu Scharlottenburg ein. Dort nutzte er die freie Zeit, die reichlich bemessen war, um seine Bildung an der Berliner Universität als Hospitant zu vervollkommnen.
Im Deutsch-Französischen Krieg zeichnete sich der Graf mehrfach durch Tapferkeit bei Sedan und bei der Belagerung von Paris aus; vielen seiner Untergebenen hat er durch überlegtes und beherztes Handeln das Leben gerettet und sich durch diese Heldentaten dauerhafte Freude gesichert. Er fiel seinen Vorgesetzten aber auch durch kluges, taktisches Geschick auf, so dass er durch den Grafen Bismarck persönlich mit einer heiklen diplomatischen Mission im bereits besetzten Frankreich beauftragt wurde. Dort gelang es ihm, einen namhaften deutschen Journalisten aus französischer Kriegsgefangenschaft zu befreien, in die jener unvorsichtige Mann unglücklicherweise geraten war. In seinem Buch Kriegsgefangen. Erlebtes 1870, das als Vorabdruck 1870/71 in der Vossischen Zeitung erschien, wird die entscheidende Rolle des Grafen freilich nicht erwähnt.
Nach dem Ende des Krieges und nach Gründung des Deutschen Reiches schied er allerdings aus dem Militärdienst aus.
Der Graf war nach dem Tode seines Vaters sein eigener Herr und dank dessen kluger Wirtschaft auch finanziell unabhängig. Da er keine Karriere innerhalb der Ministerien anstrebte, konnte er sich seine Unabhängigkeit bewahren, die es ihm in den ersten Jahrzehnten nach der Gründung des Deutschen Reiches ermöglichte, ganz seinen Neigungen zu leben.
Ein großes Interesse an der Kriminalistik, das er bereits während der Berliner Zeit entwickelt hatte, ließ ihn – in völliger Eigenverantwortung – hier ein merkwürdiges Verbrechen aufklären, dort einen unschuldig in unredliche Machenschaften verstrickten Zeitgenossen zur Hilfe eilen. Der Graf betrachtete spektakuläre und rätselhafte Verbrechen als eine Art Herausforderung; er lebte auf, wenn es galt, seine analytischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.
Wenn wir nun der Erzählfaden wieder aufgreifen, so haben wir dem Grafen gerade so viel Zeit gelassen, sich der durch jene merkwürdigen Ereignisse versammelten Personengruppe im Hause des Admirals vorzustellen und ihr von seinem leidenschaftlichen Kampf gegen die Abgründe des Verbrechens zu berichten.
Nachdem von Plechow ihn über die Ereignisse des letzten Abends und der Nacht informiert hatte, ergriff Schwedenow erneut das Wort.
„Seit längerem schon bin ich einem der größten Verbrecher auf der Spur, die dieses Jahrhundert hervorgebracht hat. Und“, fügte er grimmig hinzu, „an Verbrechern mangelt es unserem Zeitalter gerade nicht! Dieser aber, Gasparino Cortejo mit Namen, übertrifft sie alle an teuflischer Grausamkeit, Verschlagenheit und Skrupellosigkeit. Sein eigentlicher Name ist niemandem bekannt; überall bedient er sich falscher Namen, falscher Titel.“
„Aber Don Esteban war mir von der Admiralität empfohlen!“ unterbrach in von Plechow. „Er vertritt sein Land offiziell als Militärattaché! Sie müssen sich irren, Graf; der von Ihnen gesuchte Verbrecher kann nicht unser Offizier sein!“
„So, wie Sie ihn mir beschrieben haben“, erwiderte Schwedenow, „habe ich keinen Zweifel. Dieser Mann, der sich bei Ihnen unter falschem Namen eingeschlichen und ihre Tochter entführt hat, ist jener Cortejo, dem ich seit einigen Monaten schon auf den Fersen bin.“
„Ich sagte Ihnen doch, das ist unmöglich!“ beharrte der Admiral. „Niemand kann sich in eine solche Stellung einschleichen.“
„Unterschätzen sie nicht die verbrecherischen Energien dieses Mannes! Es handelt sich um das Haupt einer internationalen Verbrecherbande, die ihre Fäden über viele Länder Europas ausgebreitet hat.“
„Aber was will dieser Verbrecher mit meiner Caroline?“ schluchzten die erschütterte Mutter.
„Fassen Sie sich; Madame!“ versuchte Schwedenow die arme Frau zu beruhigen.
„So wie ich Cortejos Pläne kenne, wird er Ihrer Tochter kein Leid zufügen. Er wird sie in ein Versteck bringen, um sie anschließend in den Orient zu verkaufen, denn er befehligt hier in Europa eine Bande Mädchenhändler, die ihre einträglichen Geschäfte mit den ahnungslosen Opfern im Verborgenen abwickeln.“
Frau von Plechow aber konnte sich ob dieser Aussicht gar nicht beruhigen, mit den mehr gehauchten als gesprochenen Worten „Meine Tochter in den Orient!“ sank sie ohnmächtig zu Boden und musste von ihrem Mann in eine Nebengemach getragen werden, wo ein herbeigerufener Arzt sich der verzweifelten Mutter annahm.
Die Zurückgebliebenen bestürmten Schwedenow mit Fragen; man wollte wissen, woher er seine intimen Kenntnisse über diesen Verbrecher habe und was man unternehmen könne, das arme Mädchen aus der Gewalt des Unholds zu befreien. Neben dem Admiral und den Brüdern Verne waren der Hafenkapitän, zwei Offiziere des Stabes und Leutnant von Rochow anwesend
Schwedenow glaubte nun, da sich die arme Mutter nicht mehr unter seinen Zuhörern befand, auf jegliche falsche Rücksichtnahme verzichten zu können.
„Meine Herren, wir müssen diese Entführung sehr ernst nehmen. Sicher war sie von langer Hand vorbereitet. Ich bin durch meine engen Kontakte zum Ministerium des Innern, dem ich in ähnlichen Fällen bereits einige nicht unbedeutende Dienste leisten konnte, in die Affären eingeweiht, die, wie Sie sicher der Presse entnommen haben, immer größere Kreise zieht.“
„Wovon sprechen Sie?“ fragte Leutnant von Rochow.
„Vom Mädchenhandel natürlich“, erklärte der Graf. „In den Journalen wird doch tagtäglich darüber geschrieben.“
„Auch die französischen Zeitungen berichtete in letzter Zeit häufig von Entführungen junger Mädchen, von denen höchste Kreise betroffen waren“, bestätigte Jules.
Und Paul ergänzte: „In allen diesen Fällen tappt die Polizei im Dunklen; von den Opfern fehlt – ebenso wie von den Tätern – jede Spur.“
„Spuren haben wir schon“, erklärte der Graf, „sie führen ins Ausland, aber da sind die deutschen Polizeibehörden machtlos. Doch haben Vertreter der am meisten betroffenen Staaten vor kurzer Zeit auf einer Konferenz in Paris beschlossen, gegen diese weltweit operierenden Verbrecherbanden mit den verdeckten Mitteln der Geheimdienste vorzugehen. Die Presse erfährt zurzeit kaum etwas über die Hintergründe, damit die polizeilichen Ermittlungen den Verbrechern nicht vorschnell bekannte werden.“
Die Gesellschaft hörte nun zu ihrem Erstaunen aber auch Entsetzen aus dem Munde des Grafen, welche Machenschaften da im Verborgenen in Gang gesetzt worden waren.
Wir geben hier die Quintessenz seines Vortrags wieder, der die Zuhörer immer wieder zu Unmutsäußerungen der tiefsten Empörung veranlasste.
Der Mädchenhandel wird ein immer größeres Problem für alle zivilisierten Länder der Welt. In großen und mittleren Städten schießen Etablissements aus dem Boden, welche es auf die gemeinsten Triebe abgesehen haben. Spielhallen und Tingeltangel haben Konjunktur, in welchen englische, französische und deutsche Liedersängerinnen in der frechsten Tracht noch frechere Couplets zum Besten geben und durch Bewegung klar machen, was durch Worte nur angedeutet wird. Unten johlen die Zuschauer, Männer fast jeder Konfession, jeden Standes, und nicht nur Männer, auch halbwüchsige Jünglinge; zweifelhafte Lokale entstehen, ausgestattet mit raffiniertem Luxus, Lokale, wo feine Dirnen den Ton angeben und Lebemänner jeden Standes – vom Commis bis zum Aristokraten aus den vornehmsten Familien des Landes – zusammentreffen. Prinzen, Grafen, Offiziere in Zivil, Künstler, Schriftsteller und Studenten, ja sogar Mitglieder der Parlamente verkehren dort mit gemeinen Börsenjobbern und prostituieren sich selbst mit gefallenen Mädchen.
Und wenn der Nachschub aus den Quartieren der Industriestädte nicht ausreicht, wo das alltägliche Elend die jungen Mädchen für Versprechen anfällig macht, ohne Schutz von Vater und Mutter, die nur zu oft der Trunksucht verfallen sind, schrecken die skrupellosen Zuhälterbanden auch nicht davor zurück, junge Mädchen aus wohlanständigen Häusern mit den unverfänglichsten Versprechungen in ihren Sumpf zu locken. Sie spekulieren dabei – nur allzu oft mit Erfolg – auf die Neugierde der Mädchen, die, von den Müttern kaum aufgeklärt, hinter alle Geheimnisse des menschlichen Lebens kommen wollen, koste es, was es wolle.
Außerdem verfügen die Händler über eine besonders pestilenzialische Sorte von Lockvögeln, die so genannten Kadetten. Es sind hübsche Taugenichtse, gewandt, brutal und herzenskalt, also von der Sorte, der ein warmblütiges junges Mädel von vornherein ausgeliefert wäre. Sie operieren mit Ringen und Heiratsversprechen, verschleppen die Angeführten in irgendein verrufenes Haus, kehren von Zeit zu Zeit wieder, um die junge Braut zu trösten, und lassen die Verzweifelte dort, bis sie genügend eingearbeitet ist. Ja sie setzten sogar Drogen aus exotischen Ländern ein, um ihren arglosen Opfern den Willen zu brechen und sie zu hilflosen Opfern ihrer menschenverachtenden Machenschaften herabzuwürdigen.
Das Hauptquartier des unverblümten Mädchenhandels ist bekanntlich New York, wo alljährlich etwa fünfzehntausend europäische Sklavinnen, zum größten Teil aus Russischpolen, Galizien, Ungarn, Rumänien, Österreich, aber leider zu acht Prozent (das sind immerhin 1200 Opfer) auch aus Deutschland, zum Verbrauch für die amerikanischen Bordelle abgeliefert werden.
„Können die Polizeibehörden der europäischen Staaten denn gar nichts gegen diese finsteren Machenschaften unternehmen?“ fragte Paul empört, indem er vor Erregung aufsprang.
Schwedenow musste zu seinem Bedauern verneinen.
„Wegen der Bestechlichkeit der Organe der Hafenbehörden und des Hineinspielens von Politikern, die solche Schmiergelder für Agitationszwecke brauchen, teils wegen der lavierten Formen des Geschäfts ist jede Bemühung einer Abhilfe bisher vergebens gewesen.“
Und dies ist die Fortsetzung der schlimmen Enthüllungen, die der Graf seinen entsetzten Zuhörern offenbaren musste:
Der Weg, den diese Mädchen nehmen, lässt sich genau verfolgen. Von Hamburg werden sie in alle Welt verschifft, nach Südamerika, Bahia, Rio des Janeiro, Montevideo oder Buenos Aires, wohin ein Hauptteil verschwindet, während ein kleiner Rest durch die Magelhaensstraße nach Valparaiso geht. Ein anderer Strom wird über Kopenhagen nach Nordamerika gerichtet; er verteilt sich den Mississippi hinab bis nach New Orleans und Texas oder gegen Westen nach Kalifornien. Von dort aus wird die Küste bis hinunter nach Panama versorgt, während Cuba, Westindien und Mexiko ihren Bedarf von New Orleans beziehen. Scharen deutscher Mädchen werden über die Alpen nach Italien exportiert und wandern dann weiter südlich nach Alexandrien, Suez, Bombay, Kalkutta bis Singapur.
Am schlimmsten aber sind die Stätten der Unzucht, des Rauschgifts und des Verbrechens in den Hafenstädten Asiens wie Hongkong und Shanghai. Dort, wo die Polizei der zivilisierten Länder keinen Zugriff mehr hat, fühlen sich die unwürdigsten Vertreter aller Länder und Rassen völlig unbehelligt bei ihrem unsittlichen Treiben und leben ihre gemeinsten Phantasien frei aus. Aus den Tiefen der Länder und Nationen tauchen dunkle Existenzen auf, welche die Gunst des Augenblicks zu nutzen verstehen und sich durch verbrecherische Taten riesige Vermögen anzueignen wissen. Neben dem Rauschgifthandel blüht in diesen Jahren der Handel mit europäischen Mädchen; besonders aber sind in den letzten Jahren junge Damen aus großbürgerlichen oder gar adligen Häusern gefragt, die aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Portugal, Russland, Belgien, den Niederlanden, Schweden-Norwegen, Dänemark und der Schweiz angeworben oder mit Gewalt entführt werden, um im Orient, in Asien oder Übersee an reiche Potentaten verkauft zu werden, die mit diesem wohlfeilen Menschenmaterial ihre tierischen Instinkte zu befriedigen suchen.
Hier endete der Vortragende und blickte in die betroffenen Gesichter seiner Zuhörer.
Nach diesen Ausführungen, die von allen mit Abscheu und großer Anteilnahme verfolgt wurde – Leutnant von Rochow war noch einen Grad blasser geworden –, schlug Schwedenow vor, noch einmal nach dem Bahnhof zu gehen, um den möglichen Zielpunkt des Geflohenen und seines Opfers in Erfahrung zu bringen. Das hielten alle für einen richtigen Entschluss; man verabredete sich, gegen Mittag erneut im Hause des Admirals zusammenzutreffen. Die Vernes hatten einige Dispositionen bezüglich ihres Schiffs zu treffen, Schwedenow begab sich in Begleitung des jungen von Rochow zur Bahnstation und der Admiral sorgte sich um den bedenklichen Gesundheitszustand seiner Gemahlin.
Als sich die Gesellschaft gegen Mittag erneut im Hause des Admirals versammelt hatte, warteten alle darauf, dass Schwedenow sprechen würde. Die Männer hatten instinktiv begriffen, dass dieser Mann den entschiedenen Willen besaß, der für sie in dieser Angelegenheit nur vorteilhaft sein konnte. Anwesend waren neben dem Admiral die höheren Offiziere des Standortes, sowie der Leutnant von Rochow und die Brüder Verne, die es als ihre menschliche Pflicht ansahen, ihrem Gastgeber in dieser Angelegenheit beizustehen.
Das Angebot eines Imbisses lehnte man wegen der nicht unbeträchtlichen Aufregung ab, die alle ergriffen hatte. Nachdem der Admiral auf die vielfachen Fragen betont hatte, dass es seiner Gemahlin den Umständen entsprechend gut gehe, begann Schwedenow seinen Bericht.
„Der Zug, den Cortejo in aller Frühe benutzt hat, fährt nach Hamburg und ist dort zum jetzigen Zeitpunkt längst angekommen. Ich habe nach der Hamburger Hafenmeisterei telegraphiert und um Auskunft über alle noch heute auslaufenden Schiffe gebeten. Die Depesche wird mir, sobald sie eingetroffen ist, vom Bahnhof hierher zugestellt.“
„Und was erhoffen Sie sich von dieser Nachricht?“ wollte Paul wissen.
„Cortejo wird Deutschland auf dem schnellsten Weg verlassen, da bin ich ganz sicher“, antwortete der Graf. „Wenn wir einen Hinweis bekämen, wohin er sich wendet, gäbe es noch eine Chance, weitere Verbrechen zu verhindern.“
„Wieso ist Fräulein Caroline nur mit ihm gegangen?“ fragte von Rochow mit verzweifeltem Blick.
„Er wird sie mit einem Gifttrank“ – der junge Offizier fuhr bei diesem Wort mit einem Seufzer auf, aber der Graf ließ ihn nicht zu Wort kommen –, „der ansonsten harmlos ist – ihrer Widerstandskraft beraubt und sie zu einem willfährigen Werkzeug seine Absichten gemacht haben“, erklärte Schwedenow.
Der Leutnant wusste vor ohnmächtiger Wut kaum an sich zu halten. Schwedenow konnte ihn nicht beruhigen, versprach aber, alles Menschenmögliche in Erwägung zu ziehen. „Sie müssen wissen, dieser Cortejo kennt sich von seinen langjährigen Reisen durch die Länder des Orients und Asiens mit allerlei Drogen und Giften gut aus Er kennt geheime Essenzen, die denjenigen, dem sie mit Gewalt oder ohne sein Wissen eingeträufelt werden, das wache Bewusstsein trüben und ihm darüber hinaus so betäuben, dass sein Körper allen Befehlen seines Peinigers willenlos Folge leistet, obwohl sein innerstes Selbst sich gegen alles moralisch entrüstet, das ihm sein Gegner aufnötigt und zumutet.“
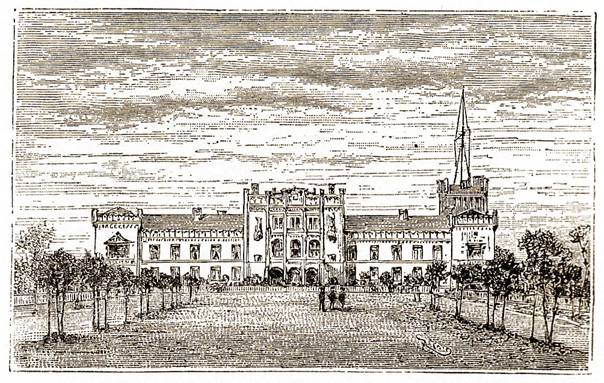
In der Gesellschaft breitete sich Unruhe aus, als ein Bahnbeamter eingelassen wurde, der dem Grafen eine Depesche überreichte. Dieser erbrach den Umschlag, überflog das Telegramm und stieß einen Ruf der Überraschung aus.
„Was ist Ihnen?“ fragte der Admiral.
„Vor einer Stunde hat die >La Gaviota< den Hamburger Hafen mit Ziel Kopenhagen verlassen! Das ist unsere Chance!“
Die Herren blickten den Grafen verständnislos an. Jules fragte den Deutschen: „Könnten Sie uns vielleicht erklären, was es mit diesem Schiff auf sich hat, Monsieur Schwedenow?“
„Dieses Schiff“, begann der Graf seine Erläuterung, „wird von dem berüchtigten Piratenkapitän Henrico Landola befehligt, einem alten Spießgesellen Cortejos, der so viele Morde und andere Verbrechen auf dem Kerbholz hat, das kein irdisches Gericht in der Lage wäre, sie auch nur annähernd zu sühnen. So viel ich in Erfahrung bringen konnte, nutzen die Bande der Mädchenhändler unter Führung Cortejos die >La Gaviota< als Versteck und Zufluchtsort bei ihren Verbrechen. Jetzt scheint dieses Schiff auf dem Weg zu jenem Hauptquartier zu sein, von dem aus die Machenschaften der Verbrecherorganisation gelenkt werden. Dorthin bringen sie die entführten Mädchen aus allen Teilen Mitteleuropas. Denn“, fügte Schwedenow mit einem Blick auf den Admiral hinzu, „Ihre Tochter ist nicht das erste Opfer. So weit mir bekannt ist, haben sich in den letzten fünf Monaten allein im Norden Deutschland mindestens zehn weitere Entführungen ereignet. Und immer stammten die jungen Damen, auf die er die Verbrecher abgesehen hatten, aus gutem Hause.“
Jules fasste sich als erster und fragte sichtlich empört:
„Was aber können wir tun, um diesem Verbrecher das Handwerk zu legen?“
Die Herren stimmten dieser entschlossen vorgetragenen Frage mit Blicken zu und schauten den Grafen fragend an. Schwedenow sagte mit ruhiger Stimme:
„Ich brauche ein schnelles Schiff, vielleicht könne wir in Kopenhagen die Räuberhöhle ausräuchern, noch bevor Cortejo seine Beute in den Orient zu bringen vermag. Ich werde mich auf dem schnellsten Weg nach Hamburg begeben und sehen, ob ich dort einen passenden Liner finde.“
„Ein Schiff haben wir. Ich stelle Ihnen die >Saint Michel< zur Verfügung, nicht wahr. Paul?“
Paul stimmte seinem Bruder sofort zu und erläuterte:
„Wir hatten sowieso die Absicht, die Küste Jütlands hinauf zu segeln. Warum nicht nach Kopenhagen?“
Schwedenow blickte den beiden Franzosen eine kurze Zeit gerade in die Augen. Dann sagte er entschlossen: „Danke, meine Herren. Ich nehme Ihr Angebot an. Könne wir morgen früh in See stechen?“
„Mit dem größten Vergnügen!“ antwortete Jules und seine Augen blitzten unternehmungslustig. „Wir erwarten heute Abend noch einen Passagier und stehen dann zu Ihrer Verfügung.“
„Haben die Herren noch Platz an Bord?“ fragte der Admiral. „Ich möchte mich Ihrem Unternehmen anschließen.“
Die Brüder überschlugen schnell ihre Passagierkapazität; Paul antwortete:
„Wenn Sie einige Unbequemlichkeiten in Kauf zu nehmen bereit sind, wird sich das einrichten lassen.“
Schwedenow aber überzeugte den Admiral, dass es besser sei, wenn er zurückbliebe, um sich seinen dienstlichen Aufgaben zu widmen, außerdem benötige seine ernsthaft erkrankten Gemahlin dringend seines Beistandes. Er schlug vor, dass ihn stattdessen Leutnant von Rochow auf der Reise begleiten solle, was der junge Mann mit lebhafter Zustimmung quittierte. Schließlich willigte von Plechow ein, entließ seine Offiziere und sorgte dafür, dass den zurückbleibenden Herren nun doch eine kleine Stärkung gereicht wurde.
Der Admiral ließ inzwischen Seekarten holen, und man hielt Kriegsrat.
„Wir schreiben heute den 16. Juni“, begann Schwedenow; die >La Gaviota< ist ein Segler, der nur mit einer schwachen Hilfsmaschine ausgerüstet ist. Sie wird frühestens am 19. Juni in Kopenhagen eintreffen. Wie schnell läuft Ihr Schiff, meine Herren?“
„Nun, die beiden Maschinen verleihen unserer Jacht eine Geschwindigkeit von 9 bis 9½ Knoten in der Stunde.“
„Diese Geschwindigkeit kann mit Hilfe der Segel bei günstigem Wind auf bis zu 10½ Knoten gesteigert werden“, ergänzte Paul.
„Das bedeutet, dass wir frühestens am 20. in Kopenhagen sein können, also einen Tag nach der >Gaviota<.“
„Ich möchte Ihnen da widersprechen, Graf!" mischte sich der Admiral ins Gespräch. "Vielleicht können Sie einen Tag gewinnen, wenn Sie durch den Eiderkanal fahren und so die direkte Linie über Kiel nach Kopenhagen nehmen.“
„Wie?“ fragte Jules erstaunt, „gibt es denn eine Kanalverbindung zwischen Nord- und Ostsee?“
„O ja“, antwortete Schwedenow, „bereits seit fast hundert Jahren. Sie durchquert die Provinz Holstein. Sehen Sie hier, meine Herren! Man quert die Deutsche Bucht, lässt Hamburg im Süden liegen und dampft bis zur Eidermündung nach Tönning. Von da geht es das Flüsschen Eider hinauf bis zur Festung Rendsburg. Dort beginnt der Eiderkanal, der uns direkt nach der Kieler Förde führt. Wir sparen auf diese Weise mehr als dreihundert Seemeilen und erreichen Kopenhagen vielleicht sogar noch vor Cortejo.“
Diese Erklärung wurde mit Beifall aufgenommen. Paul aber fragte mit einiger Besorgnis:
„Der Kanal ist doch sicher durch Schleusen unterbrochen; vielleicht sind diese zu kurz, um sie mit der >Saint Michel< zu passieren.“
„Das glaube ich nicht“, mischte sich Leutnant von Rochow in das Gespräch ein; wie lang ist Ihre Yacht?“
„Mit dem Bugspriet so um sechsunddreißig Meter.“
„Das ist freilich viel, doch ich bin vor einem halben Jahr von Kiel hierher mit einem Kanonenboot durch den Kanal gedampft. Wenn Sie erlauben, lasse ich das Kanonenboot und Ihre Jacht vermessen und wir wissen, woran wir sind.“
Diesem Vorschlag wurde allgemein zugestimmt; eine Ordonnanz erhielt den Befehl, die >Saint Michel< mittels einer Leine zu vermessen; kurze Zeit später stellte sich heraus, dass das Kanonenboot um mehr als einen Meter länger war. Von Plechow hatte nach Rendsburg zum dortigen Kommandanten telegraphieren lassen und hielt die Antwort auf seine Anfrage bereits in Händen, als die Männer vor der Vermessung der Schiffe zurückkehrten.
„Die Abmessungen der Schleusenkammern sind für mittlere Seeschiffe des 18. Jahrhunderts ausgelegt,“ begann der Admiral seinen Vortrag. „Das Schleusenmaß beträgt 35 x 7,8 Meter bei 3,5 Meter Tiefe, genügt das, meine Herren?“
„O ja“, stimmte Paul zu. Unsere Yacht ist, wenn wir den Bugspriet abmontieren, 33 Meter lang und etwas mehr als 4 Meter breit; der Tiefgang beträgt 2,40 m.“
„Ausgezeichnet, Monsieur Verne! Das Kanalmaß beträgt 7,45 Meter Breite und ist für 2,68 Meter Tiefgang ausgelegt. Der Durchfahrt Ihrer Yacht steht keine Hindernis mehr im Weg.“
Damit war die Reiseroute beschlossene Sache. Schwedenow mahnte zu sofortiger, umsichtiger Vorbereitung. Dank des energischen persönlichen Einsatzes des Admirals liefen die notwendige Vorbereitungen für die Expedition mit militärischer Präzision ab. Der Brüder Verne eilten zu ihrem Schiff, um zusätzliche Kohlen zu bunkern und weitere Lebensmittel an Bord zu nehmen, die ihnen aus den Marinevorräten zur Verfügung gestellt wurden.
Man denke sich dieses Bild! Deutsche Marinesoldaten rüsteten in Windeseile und mit preußischer Gründlichkeit eine französische Privatjacht für eine Verbrecherjagd in Dänischen Gewässern aus! Und das im Jahre 1881, gerade 10 Jahre nach Beendigung des Deutsch-Französischen Krieges und 16 Jahre nach dem Sieg der Preußen über die Dänen!
Hier in Wilhelmshaven, in einem deutschen Marinestützpunkt, hatten sich Männer zusammengefunden, die entschlossen waren, gemeinsam einem Verbrecher das Handwerk zu legen, der über die nationalen Grenzen hinweg seine unheilvollen Machenschaften betrieb, die einen jeden fortschrittlich denkenden zivilisierten Menschen zu heller Empörung treiben mussten.
Der Admiral verwendete die Nachmittagsstunden darauf, um telegraphisch bei allerhöchster Stelle in Berlin Rückendeckung für die Expedition einzuholen; Schwedenow nutzte klug seine guten Verbindungen ins Außenministerium, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die >Saint Michel< auch in dänischen Hoheitsgewässern alle erforderliche Unterstützung bekommen würde.
Am frühen Abend waren die Vorbereitungen abgeschlossen; Schwedenow und von Rochow waren mit ihrem Gepäck bereits auf das Schiff gekommen und hatten sich ihre Kabinen anweisen lassen. Sie aßen mit den Brüdern Verne ein improvisiertes Abendbrot und besprachen Einzelheiten ihrer bevorstehenden Reise.

Währenddessen schloss der Bursche von Graf Schwedenow bereits Freundschaft mit dem Schiffskoch Paul Arago. Der kleine untersetzte Franzose, dem man an der Leibesfülle die Profession ansehen konnte, war der richtige Partner für Ernst Pötsch. Dieser konnte zwar so wenig Französisch wie jener Deutsch, doch das tat der Verständigung keinen Abbruch, den auch Pötsch war mit Leidenschaft Koch.
Pötsch war zu diesem Zeitpunkt 45 Jahre alt; ein kleinwüchsiger Mann, dessen Gesichtsbildung und Gebaren ihn als einen Menschen auswiesen, der dreimal gebeten werden musste, ehe er es wagte, eine Bequemlichkeit anzunehmen. Aufgewachsen auf einen Gutshof in Arndtsdorf, ganz in der Nähe des Lieproser Herrenhauses, konnte er im Alter von 17 Jahren den damals gerade sechsjährigen Grafen aus der Pferdeschwemme vor dem Ertrinken retten. Die Dankbarkeit des alten Grafen ermöglichte dem Tagelöhnersohn eine – wenn auch bescheidene – Schulbildung in den Elementarfächern und eine leichte Dienertätigkeit im Herrenhaus.
Als der junge Graf seinen Militärdienst antrat, fragte er Pötsch, ob er ihn als Bursche begleiten wolle. Pötsch ging ohne große Begeisterung mit nach Berlin und nutzte dort die Freiheit, die ihm der Graf ließ, um sich auf seine Weise weiter zu bilden. Bald hatte er sich einiges Wissen um die Kochkunst erworben; denn das war seine Leidenschaft: Ernst Pötsch aß nicht nur gerne, er kochte auch leidenschaftlich. Und darin fand er im Grafen einen großzügigen Förderer. So entwickelte sich zwischen den beiden ungleichen Männern fast eine Art Freundschaft, zumindest eine Beziehung, die für damalige Zeiten ungewöhnlich war. Der Graf konnte sich vor Paris übrigens für die rettende Tat seines Burschen revanchieren, indem er Pötsch aus einem Haufen berittener Franzosen heraus haute, ohne dabei sein eigenes Leben zu schonen.
Die Notwendigkeit auf dieser abenteuerlichen Reise zwang Pötsch, der zu Beginn der Fahrt in der Burschenkammer am Heck der Yacht einquartiert wurde, später sogar, mit einem einfachen Logis in der Kombüse der >Saint Michel< vorlieb zu nehmen, da wegen der unerwarteten Passagierschwemme selbst die Burschenkammer durch Leutnant von Rochow belegt werden musste. Und weil Paul Arago sowieso in seiner engen Küche lebte, musste sich zwischen diesen beiden so unterschiedlichen Menschen, die durch eine gemeinsame Leidenschaft verbunden waren, bald eine enge Freundschaft entwickeln. Für die Passagiere bedeutete dieses schicksalhafte Zusammentreffen einige kulinarische Höhepunkte, die man aber wegen des aufregenden Anlasses der Reise und einiger abenteuerlicher Entwicklungen nicht immer so recht genießen konnte. Ganz besonders galt das für den jungen Leutnant, der aus Sorge für seine angebetete Caroline wenig Interesse für die gute französisch-deutsche Gemeinschaftsküche aufzubringen vermochte. Immerhin durften die Passagiere der >Saint Michel< auf Genüsse rechnen, die sich aus der schicksalhaften Begegnung von schleswig-holsteinischer Hausmannskost und bretonischer Kochkunst ergeben sollten. Die erzwungene Liaison der beiden ungleichen Partner blieb selbst für diejenigen der Reisegesellschaft ein Fauxpas, die nur gelegentlich die Höhen der Feinschmeckerei zu erklimmen vermochten; dennoch übten beide in ihrer durch den Zufall erzwungene Gemeinschaft einen unwiderstehlichen Reiz aus, von dem sich selbst erprobte Gourmets wie die Brüder Verne gern verführen ließen. Doch davon später.